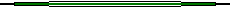Sie litt schwer darunter und wollte sich befreien. Aber wiewohl
sie starker Empfindungen fähig war, so war sie doch keine
starke Natur; ihr fehlte die Nachhaltigkeit, und alle guten Anwandlungen
gingen wieder vorüber. So trieb sie denn weiter, heute, weil
sie's nicht ändern konnte, morgen, weil sie's nicht ändern
wollte. Das Verbotene, das Geheimnisvolle hatte seine Macht über
sie.
Was mit diesen wenigen Sätzen angedeutet ist, heißt nichts anderes, als dass
Effi sich nach der Schlittenfahrt mit Crampas verabredet hat und sich nun
regelmäßig heimlich mit ihm trifft - in einem Haus in den Dünen, wie sehr viel
später (
Kap.27, Abs.15)
erschließbar wird. Das Versteckte dieser Andeutungen
ließ bei Erscheinen des Romans viele rätseln, ob überhaupt etwas und wieviel in dem
Verhältnis mit Crampas geschehen sei. Joseph Victor Widmann in seiner Rezension
im Berner BUND vom 17. November 1895 schreibt:
Dagegen kommt die Mitteilung, daß Effie wirklich den
Verführungskünsten des Majors unterlegen ist, dem Leser
doch etwas unerwartet; die Schlittenfahrt genügt nicht ganz,
ihren Fall glaubhaft zu machen. Es sind so viele gesunde
Züge in dieser von allen Lesern und Leserinnen geliebten
Effie, daß wir bei der ersten Andeutung des Dichters, der
Schritt vom Wege sei gethan worden, ganz bestürzt sind. Ich
kann mir freilich vorstellen, daß es dem auf seinem schönen,
freien Astronomenturm des Alters wohnenden Dichter nicht
mehr ums Herz war, den Blick, der nach strahlenden Sternen
ewiger Güte und Weisheit ausschaut, lange in die
Niederung der Leidenschaften zu senken, in jene Gegend, wo
Malarianebel den Sumpf andeuten. Doch scheint mir,
Effies Fall komme zu plötzlich, stehe zu unerwartet als
vollendete Thatsache da.
In einer Rezension in "Westermanns Illustrierten Deutschen Monatsheften"
(40. Jahrgang, Bd. 80, September 1896) wird sogar angenommen, dass Effi nur
"durch eine Flirtation, die vor der Ehe gar nicht gefährlich sein würde,
ein Duell veranlaßt" habe, wird also der wahre Sachverhalt überhaupt nicht
erkannt. Friedrich Spielhagen wiederum in seinem Aufsatz "Die Wahlverwandtschaften
und Effi Biest" breitet die Andeutungen detailliert vor sich aus, um sich der
Richtigkeit seiner Vermutung zu versichern:
Vielleicht, daß mancher Leser wünscht, der Dichter wäre in
der Darstellung der Liebesaffaire ausführlicher, weniger
diskret gewesen; und sich beklagt, er wisse jetzt nicht, wie
weit sich denn eigentlich die Unglückliche verschuldet. ... Und wer
sich aus ihrem nachträglichen Seelenzustand, ihrer Angst vor Entdeckung, ihrem
Ekel bei Erinnerung des Geschehen die Höhe ihrer Schuld noch immer nicht
herausrechnen kann, dem wird sie klar werden bei dem Benehmen des Gatten
nach der Entdeckung. Um einer bloßen Flirtation willen - besonders, wenn
sie sechs Jahre zurückliegt und die Betreffende seitdem auch nicht den
kleinsten Schritt vom Wege gewichen ist - fühlt auch ein so korrekter Mann,
wie Innstetten, sich nicht so beleidigt, daß er den ehemaligen Rivalen fordern
und totschießen muß.




 Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur
sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn
schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang
dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,
der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:
Fontanes Gestaltungsarbeit an "Effi Briest" beginnt bei den Namen. Die Hauptfigur
sollte zunächst Betty von Ottersund heißen, später Betty von Pervenitz. Wenn
schließlich Effi Briest daraus wurde, hat das offenbar hauptsächlich mit dem Klang
dieses Namens zu tun. An den Herausgeber der "Deutschen Rundschau", Julius Rodenberg,
der den Roman im Vorabdruck herausbringen wollte, schreibt Fontane im November 1893:

 Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen
Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978
erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster
wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche
einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern
oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.
Gleich die Eingangsszene mit ihrer Beschreibung des von drei Seiten umschlossenen
Briest'schen Gartens ist einer sehr weitgehenden Deutung unterzogen worden. In der 1978
erschienenen Arbeit "Effi Briest - ein Leben nach christlichen Bildern" von Peter Klaus Schuster
wird darin eine Anspielung auf mittelalterliche Marien-Darstellungen gesehen. Der Garten gleiche
einem 'hortus conclusus', einem geschlossenen Garten, wie er auf mittelalterlichen Bildern
oft zu sehen sei, und setze so Effi mit der jungfräulichen Maria gleich.

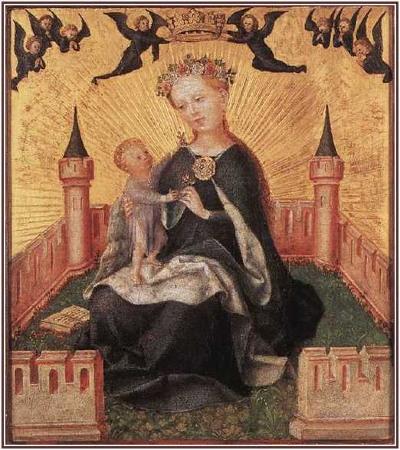
 Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman
eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben
entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für
den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.
Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung
der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.
Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige
sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.
Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des
Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder
entspreche.
Ausgehend von dieser Deutung entwickelt Schuster die These, dass der gesamte Roman
eigentlich eine Marien-Geschichte sei: Effis Leben
entspreche dem Leben, der Passion und der Himmelfahrt Marias. Innstetten steht dabei für
den allmächtigen Gott, Crampas für den Teufel und Annie für das Jesuskind.
Fazit dieser Auslegung: Fontane habe mit seinem Roman die unchristliche Unterdrückung
der Frau durch das männlich dominierte Christentum seiner Zeit brandmarken wollen.
Dieses Christentum nehme die Unschuld der Jungfrau Maria nicht mehr wahr oder versündige
sich gar 'teuflisch' an ihr, und sogar die Tochter Annie, sprich Jesus Christus, lasse sie im Stich.
Immer wieder lägen 'christliche Bilder', von Schuster auch wiedergegeben, den Szenen des
Romans zugrunde, so wie eben auch der Briest'sche Garten dem Hortus conclusus der Marienbilder
entspreche.
 Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata
Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst
bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,
das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit
lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser
Analogien kann man eigentlich nur lachen.
Was ist von dieser Deutung zu halten? Karl S. Guthke hat sie zu Recht eine Fata
Morgana genannt, die sich mit ihren 'Beweisen' bis ins Komische hinein selbst
bloßstelle. Und in der Tat: Effis Schaukel mit ihren Stricken als Galgen,
das Haus in Kessin mit Haifisch und Krokodil als Stall von Bethlehem, Crampas mit
lädiertem Arm statt klumpigem Fuß als Teufel usw. - über viele dieser
Analogien kann man eigentlich nur lachen.
 Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster
im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen
werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich
eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht
haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird
von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,
dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt
hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens
einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches
Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und
noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke
an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.
Auf die diversen weiteren - vermeintlichen - Gestaltungselemente, die Schuster
im Rahmen seiner Deutung benennt, soll deshalb hier nicht mehr eingegangen
werden. Denn die nächstliegende Frage, warum Fontane sich
eine so verdeckte und versteckte Kritik des Christentums ausgedacht
haben soll, wo er es doch gleichzeitig ganz unverdeckt kritisiert, wird
von Schuster erst gar nicht gestellt. Dabei ist grundsätzlich nicht unrichtig,
dass Fontane sich durch die Bildende Kunst hat anregen und in seinem Blick auf die Welt
hat beeinflussen lassen, und so mag auch die 'Geschlossenheit' des Briest'schen Gartens
einer solchen Anregung zu danken sein. Es genügt aber auch, hier als symbolisches
Element den Friedhof wahrzunehmen, insofern Friedhöfe dann auch in Kessin und
noch wieder für Effis zweite Wohnung in Berlin in den Blick kommen. Der Gedanke
an den Tod, so kann man dies deuten, soll Effis Lebensweg von Anfang an begleiten.