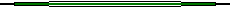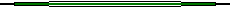»Das kann wohl geschehen«, versetzte Eduard, »bei Menschen, die nur dunkel vor sich hinleben, nicht bei solchen, die,
schon durch Erfahrung aufgeklärt, sich mehr bewusst sind«.
Ironie des Erzählers! Nicht nur wird sich herausstellen, dass die von Charlotte befürchtete Änderung des Verhältnisses der Gatten zueinander eintritt, es ist auch Eduard gerade nicht der Mensch, der sich seiner selbst in dem behaupteten Sinn 'bewusst' ist.
Zweites Kapitel
»Es möchte noch zu wagen sein«, sagte Charlotte bedenklich, »wenn die Gefahr für uns allein wäre.
Glaubst du denn aber, dass es rätlich sei, den Hauptmann mit Ottilien als Hausgenossen zu sehen ...«
Es ist nicht recht durchschaubar, was Charlotte hier befürchtet. Eigentlich sollte sie nicht viel dagegen haben, dass der auch von ihr geschätzte
Hauptmann an Ottilie Gefallen finden könnte oder sie an ihm. Ottilie ist ein Waisenkind, mittellos, anscheinend nicht einmal besonders anziehend - müsste
Charlotte nicht sogar daran gelegen sein, ihr zu einem Ehemann zu verhelfen? Ein Standesunterschied kann nicht vorliegen, wenn der Hauptmann mit Eduard in derselben
Pension erzogen wurde und mit ihm auf Reisen war. Anders als Eduard ist er nur nicht vermögend. Später wird Charlotte ihn ja sogar selbst
für Ottilie in Erwägung ziehen (siehe
ZWEITER TEIL, ZEHNTES KAPITEL). Denkt sie hier also noch
an eine bessere Partie für sie? Oder meint sie umgekehrt, dass der Hauptmann sich reicher verheiraten sollte?
Solche Fragen werden nicht gestellt, weil Eduard, als kennte er Charlottes verborgene Gedanken, nur äußert, dass Ottilie auf ihn nicht den mindesten Eindruck gemacht hätte. Charlotte ist damit auch zufrieden und spricht über Ottilies Wirkung auf den Hauptmann weiter kein Wort mehr. Anscheinend hat sie ihn mit ihren Bedenken gar nicht gemeint.
~~~~~~~~~~~~
... so wär es für jeden andern schwer gewesen, ein Duett mit ihm durchzubringen. Aber Charlotte wusste sich darein zu finden; sie hielt
an und ließ sich wieder von ihm fortreißen und versah also die doppelte Pflicht eines guten Kapellmeisters und einer klugen Hausfrau ...
Im Gegensatz zu diesem kalkulierten Umgang mit Eduards Flötenspiel kann sich Ottilie mühelos in einer Art seelischem Gleichklang auf Eduard einstellen (siehe die Schilderung im
ACHTEN KAPITEL).
Drittes Kapitel
»... Heißt nicht einer Otto so gut als der andere?«
Die Namensgleichheit setzt sich noch darin fort, dass ebenso Charlotte wie Ottilie ein "Otto" in ihren Namen haben. In der Fachliteratur wird das als großes Kunststück
ausgerufen. Überdies wird bemerkt, dass man "Otto" als Palindrom vorwärts und rückwärts lesen kann, wenn auch dem Wort wie dem echten Palindrom die Mitte fehlt.
Dafür gibt es den Mittler, der zwischen den vier Personen zu 'vermitteln' sucht, was in dem chemischen Buchstabengleichnis von A-B-C-D gerade nicht vorgesehen ist.
Für signifikant wird auch gehalten, dass "otto" italienisch acht heißt, was wiederum mit dem Inhalt oder gespiegelten Inhalt der vierten und achten Kapitel des ersten und
zweiten Teiles korrespondieren soll. Auch dass es zwei Teile zu je achtzehn Kapitel sind, die teils spiegelbildlich, teils parallel aufeinander bezogen zu sein scheinen, gehört dazu. Schließlich wird noch bemerkt, dass in der Reihenfolge des Auftretens die Anfangsbuchstaben von Eduard, Charlotte, Hauptmann und Ottilie ein ECHO ergeben, wobei die äußeren und inneren Zeichen als Personen einander antworten und Ähnliches mehr.

Was jedoch besagt das? Es bildet sich darin nur ab, was auch auf der Textebene ausgesprochen wird: dass es eine schicksalhafte Bindung zwischen diesen Menschen gibt. Wenn Goethe diese Bindung zusätzlich über Namen und Zahlen verdeutlicht hat oder haben sollte, so erklärt sich das aus seinem Interesse, den als Gattung wenig geschätzten Roman künstlerisch aufzuwerten. Das ist ihm auch gelungen, allerdings hauptsächlich über den Inhalt und nicht aufgrund solcher ausgeklügelter Gestaltungsmomente.
~~~~~~~~~~~~
Auch kann ich ihre große Mäßigkeit im Essen und Trinken nicht loben.
... Ja, sie macht sich irgendein Geschäft, um eine Lücke auszufüllen, wo die Dienerinnen etwas versäumen, nur um eine Speise oder
den Nachtisch zu übergehen.
Die Weigerung Ottilies, normal zu essen, kann man mit dem heutigen Begriff der Magersucht kennzeichnen. Dieser Zug an ihr wird noch mehrmals berührt und bereitet vor, dass sie sich am Ende buchstäblich zu Tode hungert. Im Grunde liefert Goethe damit die erste Beobachtung der Krankheit, die Anorexia nervosa heißt, eine seelisch bedingte Essstörung, die keineswegs hauptsächlich mit dem heute vermuteten Schlankheitswahn zu tun hat. Die tiefere Ursache sind Bindungs- und Beziehungsnöte, wie man sie an Ottilie geradezu musterhaft vorgeführt bekommt. Ob Goethe diesen Zusammenhang bei einer jungen Frau in seiner Umgebung wahrnehmen konnte, ist nicht bekannt, aber es liegt nahe.
Viertes Kapitel
... als bei der Nähe so mancher Teiche, Gewässer und Wasserwerke öfters ein und der andere Unfall dieser Art vorkam. Diese Rubrik besorgte der Hauptmann
sehr ausführlich, und Eduarden entschlüpfte die Bemerkung, dass ein solcher Fall in dem Leben seines Freundes auf die seltsamste Weise Epoche gemacht. Doch als dieser
schwieg und einer traurigen Erinnerung auszuweichen schien, hielt Eduard gleichfalls an ...
Eine Vorankündigung der Geschichte von den "wunderlichen Nachbarskindern", die im
ZWEITEN TEIL, ZEHNTES KAPITEL gesondert erzählt wird.
~~~~~~~~~~~~
Eine seiner besondern Eigenheiten, die er jedoch vielleicht mit mehrern Menschen teilt, war die, dass es ihm unerträglich fiel, wenn jemand ihm beim Lesen in das Buch sah.
Wie beim Musizieren wird auch hier vorbereitet, wie ganz anders Eduard mit Ottilie dann übereinstimmt (siehe
ACHTES KAPITEL).
~~~~~~~~~~~~
»Gut!«, versetzte Charlotte. »Wenn auch das Beispiel, wie mir scheint, nicht ganz auf unsern Fall passt ...«
Sicherlich soll diese Rede besagen, dass Charlotte das naturgesetzlich Zwanghafte einer 'Wahlverwandtschaft' in dem gegebenen Beispiel nicht erkennt. Es könnte allerdings
auch heißen, dass sie die gegenseitige Anziehung von Menschen überhaupt für so unabweisbar nicht ansieht. Darin jedoch wird sie durch das weitere Geschehen
widerlegt. Auch wenn es zunächst so aussieht, als ob Eduard sich nur nicht beherrschen könnte, wird doch mehr und mehr auf dem Naturverhängten seiner Liebe zu Ottilie
bestanden. Dass er ihr nach ihrem Tod nachstirbt, ist nur die letzte Konsequenz seiner Bindung an sie. Auch vorher schon wird ihre gegenseitige Anziehung auf unsteuerbare
Naturkräfte zurückgeführt (siehe
ZWEITER TEIL, SIEBZEHNTES KAPITEL).
Fünftes Kapitel
Unter andern rief er aus: »Es ist doch recht zuvorkommend von der Nichte, ein wenig Kopfweh auf der linken Seite zu haben; ich habe es manchmal auf der rechten. Trifft es zusammen und wir sitzen gegeneinander, ich auf den rechten Ellbogen, sie auf den linken gestützt und die Köpfe nach verschiedenen Seiten in die Hand gelegt, so muss das ein Paar artige Gegenbilder geben.«
Dass Ottilie ihr Kopfweh auf der linken Seite hat, wird zuvor nur in dem Brief der Vorsteherin mitgeteilt, von dem gar nicht gesagt wird, dass Eduard ihn überhaupt zur Kenntnis nimmt (siehe
DRITTES KAPITEL). In dem Brief jetzt heißt es sogar, dass ihr die Kopfschmerzen nicht anzusehen seien, weil sie niemals die Hand "
nach dem Schlafe zu", also zur Schläfe hin bewegt. Soll man daraus schließen, dass Eduard die Mitteilungen zu Ottilie bereits viel aufmerksamer verfolgt, als er sich den Anschein gibt? Sich also der Linksseitigkeit ihres Kopfschmerzes so sehr bewusst ist, dass ihn dessen äußere Nichtwahrnehmbarkeit gar nicht interessiert?
Die scherzende Behandlung des Themas durch ihn lässt eher doch vermuten, dass Goethe, ganz auf das Spiegelbildliche der Konstellation ausgerichtet, den Mitteilungszusammenhang nicht mehr im Blick hat. Das gilt um so mehr, als neu ein Rechts-links-Unterschied ihrer Gesichtsfarbe beim Vorkommen einer Kränkung mitgeteilt wird. Das eine kann sich leicht mit dem anderen vermischen, sodass bei der gewöhnlichen Lektüre das Entfernte der Information gar nicht auffällt.
~~~~~~~~~~~~
Eduard hingegen rief aus: »Nehmen Sie sich nur, lieber Freund, vor dem D in acht! ...«
Es ist sicherlich nur ein Flüchtigkeitsfehler, dass Eduard seinen Freund hier siezt. Sonst spricht er ihn immer mit Du an.
Siebentes Kapitel
Da zeigte sich denn, dass der Hauptmann vergessen hatte, seine chronometrische Sekundenuhr aufzuziehen, das erste Mal seit vielen Jahren; und sie schienen, wo nicht zu empfinden, doch zu ahnen, dass die Zeit anfange, ihnen gleichgültig zu werden.
Das Gleichgültigwerden der Uhrzeit ist für damals etwas hoch Bedeutsames. Die Aufklärung hatte die tägliche Zeitplanung zum Grundsatz aller vernünftigen Lebensgestaltung gemacht, und die überall an den Kirchen, Rathäusern und sonstigen Türmen angebrachten Uhren zeigten jedem an, wie spät es gerade war. Als in der Revolutionszeit in Frankreich der Plan aufkam, nicht nur einen neuen Kalender, sondern auch eine neue Tagesgliederung einzuführen - zweimal zehn Stunden für den Tag -, scheiterte das an der nicht zu bewältigenden Masse auszutauschender Uhren.
Das beflissene Wahrnehmen der Uhrzeit wurde früh auch schon verspottet. Der Mann nach der Uhr heißt eine Komödie von Theodor Hippel, erschienen 1766, in der selbst noch Liebeserklärungen minutengenau abgegeben werden. Die allgemeine Entwicklung zu einer genauen Zeitmessung war jedoch nicht aufzuhalten. Wenn den Hauptmann und Eduard die Uhrzeit nicht mehr kümmert, bedeutet das die Abkehr von einer ordentlichen, vernünftigen Lebensführung überhaupt.
~~~~~~~~~~~~
»... Tun Sie es mir zuliebe, entfernen Sie das Bild, nicht aus Ihrem Andenken, nicht aus Ihrem Zimmer; ja geben Sie
ihm den schönsten, den heiligsten Ort Ihrer Wohnung; nur von Ihrer Brust entfernen Sie etwas, dessen
Nähe mir, vielleicht aus übertriebener Ängstlichkeit, so gefährlich scheint!«
Was Eduard mit dieser Bitte meint, ist so durchschaubar, dass man sich wundert, wie er es überhaupt vorbringen kann. Natürlich will er sie, die seine Tochter sein könnte, der väterlichen Aufsicht und Obhut entziehen, weil er sie nur so zu seiner Geliebten machen kann. Die Vorstellung, eigentlich bei ihrem Vater um ihre Hand anhalten zu müssen, ist ihm so unbehaglich, dass er dessen Bild beim Umgang mit ihr nicht vor Augen haben will. Er selbst durchschaut das allerdings nicht oder gesteht es sich nicht ein, und so begründet er seine Bitte mit der Angst um eine Verletzung. Die Umständlichkeit, mit der Goethe diese Ausflucht vorbereitet, lässt aber erkennen, dass dem Leser der wahre Grund nicht verborgen bleiben soll. Wenn Eduard es nicht wagt, "das Bild an seine Lippen zu drücken", bestätigt das noch einmal sein wahres Motiv. Er fühlt, dass das Heuchelei wäre, und unterlässt es deshalb.
~~~~~~~~~~~~
Der Freund wagte nicht, das Bild an seine Lippen zu drücken, aber er fasste ihre Hand und drückte
sie an seine Augen. Es waren vielleicht die zwei schönsten Hände, die sich jemals zusammenschlossen.
Die beiden "schönsten Hände" sind ein nahezu unerträglicher erzählerischer Fehlgriff, nicht der einzige in diesem Roman, mit einem
jüngeren Begriff nur als Kitsch zu bezeichnen. Weder vorher noch später wird jemals gesagt, dass Eduard und Ottilie besonders
schöne Hände haben, und da Eduard Ottilies Hand an seine Augen drückt, könnte keiner von beiden das in diesem
Moment auch feststellen. Es spricht sich allein die Andacht des Erzählers angesichts einer ersten Liebesberührung darin aus. Nur ist es ganz unrichtig,
dass dabei das Aussehen der Hände abwägend beurteilt wird.
Achtes Kapitel
Eduard gleichfalls rückte zu, um es ihr auf alle Weise bequem zu machen, ja er hielt oft längere Pausen als nötig, damit er nur nicht eher umwendete,
bis auch sie zu Ende der Seite gekommen.
Eduards Bereitschaft, Ottilie mit in sein Buch sehen zu lassen, steht in deutlichem Gegensatz zu seiner erklärten Abneigung gegen ein solches Verhalten
(siehe
VIERTES KAPITEL). Im Glück über ihre Nähe und ihr Interesse an seinem Vortrag spielen seine
Grundsätze für ihn aber keine Rolle.
~~~~~~~~~~~~
... denn wenn es von Charlottens Geschicklichkeit und freiem Willen abhing, ihrem bald
zögernden, bald voreilenden Gatten zuliebe hier anzuhalten, dort mitzugehen, so schien Ottilie, welche
die Sonate von jenen einige Mal spielen gehört, sie nur in dem Sinne eingelernt zu haben, wie jener sie
begleitete.
Die Fähigkeit Ottilies, Eduards unregelmäßiges Spiel mühelos aufzunehmen, zeigt sie ihm viel zugeneigter und seelisch verwandter, als Charlotte das ist (siehe
ZWEITES KAPITEL).
~~~~~~~~~~~~
... und so führten beide mit Empfindung, Behagen und Freiheit eins der schwersten
Musikstücke zusammen auf, dass es ihnen und dem zuhörenden Paar zum größten
Vergnügen gereichte.
Spiegelbildlich harmonieren auch Charlotte und der Hauptmann beim Musizieren mehr miteinander als sie und Eduard. - Die symbolische Überdeutlichkeit, die
darin liegt, kann man allerdings auch schon als allzu aufdringlich und deshalb störend empfinden.
Neuntes Kapitel
Er wies es zuletzt herum, ohne es aus der Hand zu lassen, und man sah darauf die Buchstaben E und O in sehr zierlicher
Verschlingung eingeschnitten: es war eins der Gläser, die für Eduarden in seiner Jugend verfertigt worden.
Die Buchstaben E und O bedeuten nur die Taufnamen Eduard Otto, werden von Eduard aber als Eduard & Ottilie gedeutet. Das nicht zersprungene Glas kommt mit dieser Symbolik noch mehrere Male vor.
Zunächst führt Eduard es zum Beweis dafür an, das er und Ottilie füreinander bestimmt sind (siehe
ACHTZEHNTES KAPITEL und
ZWEITER TEIL, ZWÖLFTES KAPITEL), später erfährt er, dass das vermeintliche Glücksglas einem Diener zerbrochen ist und man ihm ein anderes Gleiches untergeschoben hat (siehe
ZWEITER TEIL, ACHTZEHNTES KAPITEL). So werden mit diesem Glas Eduards Aberglaube wie seine Selbsttäuschung überdeutlich gekennzeichnet.
~~~~~~~~~~~~
»Wie lange stehen sie wohl schon?«, fragte Ottilie. »Etwa so lange«, versetzte Eduard, »als
Sie auf der Welt sind. Ja, liebes Kind, ich pflanzte schon, da Sie noch in der Wiege lagen.«
Später wird sich herausstellen, dass Eduard die Platanen gerade am Tag von Ottilies Geburt gepflanzt hat (siehe
VIERZEHNTES KAPITEL).
Elftes Kapitel
»Erinnerst du dich«, fuhr der Graf fort, »welch Abenteuer ich dir recht freundschaftlich
und uneigennützig bestehen helfen ...« - »Den Hinweg zu dem Quartier der Hofdamen hatten Sie sich wohl gemerkt«, sagte Eduard.
Das vertrauliche Du, zu dem der Graf hier greift, ist zu offensichtlich ein Widerspruch zu dem bisherigen Verlauf der Begegnung, als dass man auf ein Versehen Goethes schließen darf. Der Graf will Eduard anscheinend wie früher zum Vertrauten auch in ihren Liebesangelegenheiten machen. Eduard geht darauf jedoch nicht ein und antwortet mit "Sie". Weder will er sich über sein Verhältnis zu Charlotte äußern (was der Graf geradezu herausfordert) noch gar seine Neigung für Ottilie gestehen. Deshalb kehrt auch der Graf, nachdem er für Eduard und Charlotte zunächst "ihr euch" benutzt, zum Sie zurück.
Zwölftes Kapitel

»Wollen wir kollationieren?«, sagte sie lächelnd.
kollationieren: einsammeln, einen Text auf Abweichungen hin durchsehen. Dass Ottilie diesen Fachausdruck gebraucht, ist in erkennbar ironisch gemeint.
Sie weiß sehr gut, dass das Bemerkenswerte an ihrer Abschrift nicht ihre erwartbare Fehlerfreiheit, sondern etwas anderes ist.

Er sah Ottilien an und wieder auf die Blätter, besonders der Schluss war ganz, als wenn er ihn selbst geschrieben hätte.
Auch das noch! ist man versucht zu denken. Aber es gehört diese Überdeutlichkeit in der Symbolik zu Goethes ausdrücklichem Gestaltungsplan. Die Wahlverwandtschaften seien die einzige unter seinen Dichtungen, bemerkte er im Mai 1827 gegenüber Eckermann, die er nach einer "durchgreifenden Idee" gearbeitet habe. Der Roman sei dadurch "für den Verstand fasslich geworden", fügte er hinzu, "aber ich will nicht sagen, dass er dadurch besser geworden wäre". Die 'Wahlverwandtschaft' zwischen Eduard und Ottilie soll sich in allen noch halbwegs möglichen Momenten wiederholen, damit das, was sie zueinander hinzieht, nur um so unabweisbarer erscheint. Zugleich wird dadurch aber auch der ihnen auferlegte Verzicht zu einer um so härteren Prüfung.
~~~~~~~~~~~~

Immer gewohnt, sich ihrer selbst bewusst zu sein, sich selbst zu gebieten ...
Hier wird der Unterschied zwischen Charlotte und Eduard in wörtlicher Aufnahme von Eduards Selbsteinschätzung (siehe
ERSTES KAPITEL) ganz deutlich. Eduard glaubt nur, sich "seiner bewusst" zu sein, Charlotte ist es wirklich.
Dreizehntes Kapitel
Und wird er es nicht immerfort an sein Herz drücken, obgleich entstellt durch die Unterschrift eines Dritten?
Die bei Eduard verbleibende Abschrift des Kaufvertrages über das Vorwerk brauchte eigentlich nur die Unterschrift des Käufers zu tragen - wieso ist er ein Dritter?
Gemeint ist wohl "eines anderen", wenn in dem Schriftstück sowohl Ottilies wie seine eigene Hand (oder auch seine Unterschrift) zu erkennen sind. Ottilie hat den Vertrag
jedenfalls nicht mit unterschrieben. Sonderbar bleibt, dass er die von ihr kopierten Passagen so ansieht, als stammten sie von ihm selbst.
~~~~~~~~~~~~

»... dass er nicht ganz redlich gegen Sie ist. Ich hörte ihn einmal zu
Charlotten sagen: wenn uns nur Eduard mit seiner Flötendudelei verschonte! ...«
Eine für den Hauptmann wie auch für Ottilie unerwartet abträgliche Kennzeichnung. Weder hat man vermuten können, dass der Hauptmann Charlotte
gegenüber so grob von ihrem Mann (und seinem Freund) spricht, noch würde man Ottilie diese vergiftete Mitteilung zugetraut haben. Beides passt das zu der
sonstigen Feinheit dieser Menschen nicht.
~~~~~~~~~~~~

Sie war sich ihres ernsten Vorsatzes bewusst, auf eine so schöne, edle Neigung Verzicht zu tun.
Es ist nicht ganz nachzuvollziehen, dass Charlotte auf Eduard (oder seine Liebe zu ihr) plötzlich verzichten will. Kurz zuvor sucht sie sich noch in ihrem "Wahn" zu bestärken, sie könnte in das alte Verhältnis zu ihm "
zurückkehren". Sogar "
zu Hilfe kommen" will sie dem Liebespaar jetzt, meint aber nur eine Aussprache mit Ottilie, die ja wohl keinen anderen Zweck haben kann, als diese von ihrer Hoffnung auf Eduard abzubringen. Man hat den Eindruck, dass Goethe den ihr nachgesagten Edelmut selbst nicht beim Wort nehmen will.
Fünfzehntes Kapitel
Ottiliens zartem, aufgeregtem Gemüt war dieses rauschende, blitzende Entstehen
und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard, dem diese
Annäherung, dieses Zutrauen das volle Gefühl gab, dass sie ihm ganz angehöre.
Schon die Zeitgenossen haben das Feuerwerk als die symbolische Vorwegnahme einer "Eroberung" Ottilies verstanden, derzufolge sie Eduard schüchtern zwar, aber doch schließlich zutraulich 'ganz angehörte'. Eine Bestätigung dafür fand man in Eduards Brief an sie, als er in dem Gasthaus auf sie wartet und ihr schreibt, sie habe 'manchmal an seiner Brust geruht' (siehe
ZWEITER TEIL, SECHZEHNTES KAPITEL).
... sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopferte, wie er rettete und selbst gerettet war.
Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weissagen.
Eine schwer zu erschließende Bemerkung. Was kann die Rettung eines Kindes vor dem Ertrinken für die Zukunft des Hauptmanns zu bedeuten haben? Die einzige Verbindung zu dem Romangeschehen ergibt sich über die Novelle von den "Wunderlichen Nachbarskindern" (siehe
ZWEITER TEIL, ZEHNTES KAPITEL). Während sich der Hauptmann einst als Retter seiner Braut nicht hat bewähren können, ist er jetzt ein "
geschickter Schwimmer". Mit der Rettungstat könnte also vielleicht eine Belastung von ihm abfallen, die ihn zukünftig selbstbewusster zumal gegenüber Frauen auftreten lässt. Schließlich ist er mit Ende Dreißig noch unverheiratet, während Eduard schon die zweite Ehe führt und mit Ottilie eine weitere Frau an sich zu ziehen vermag.
Eine Überlegung dieser Art liegt um so näher, als unmittelbar anschließend nachgetragen wird, was Charlotte hier schon weiß, dass nämlich der Hauptmann mit der neuen Anstellung auch die "
Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat" hat. Zwar schenkt er selbst diesem Punkt "
keine Aufmerksamkeit", aber ihre Erwartung einer 'nicht unglücklichen' Zukunft für ihn könnte sich darauf beziehen. Dass man dies nur umweghaft
erschließen kann, wird niemand für gestalterisch gelungen halten. Goethe wollte aber vielleicht den Eindruck vermeiden, dass der Hauptmann in stiller Übereinkunft seiner Umgebung regelrecht verkuppelt wird.
Sechzehntes Kapitel
... in dem zweiten Briefe des Grafen, den ihr der Hauptmann zuletzt mitteilte, war auch von einer Aussicht auf eine vorteilhafte Heirat die Rede ...
~~~~~~~~~~~~
Mit einiger Bewegung rief sie aus: »Kann Ottilie glücklich sein, wenn sie uns entzweit,
wenn sie mir einen Gatten, seinen Kindern einen Vater entreißt?«
Da Charlotte bisher nur ein Kind hat, Luciane, kann die Benutzung der Mehrzahl von ihrer Seite nur bedeuten, dass sie sich von Eduard schwanger weiß. Er selbst bemerkt das allerdings nicht, obwohl er antwortet, für "unsere Kinder" wäre gesorgt. Es ist sonderbar, dass ihm die Formulierung nicht auffällt.
Siebzehntes Kapitel
Auch auf dem Boden mochte sie nicht verweilen. Sie sprang in den Kahn und ruderte sich bis mitten in den See; dann zog sie eine Reisebeschreibung hervor, ließ sich von den bewegten Wellen schaukeln ...
Hier zeigt sich Ottilie im Umgang mit dem Ruderboot so geübt, dass man ihre spätere Ungeschicklichkeit nicht begreift (siehe
ZWEITER TEIL, DREIZEHNTES KAPITEL).
| Gestaltungsmerkmale /Zweiter Teil |
Erstes Kapitel
Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen, dass nämlich, wenn die Hauptfiguren
sich entfernen, ... gleich sodann schon ein Zweiter, Dritter, bisher kaum Bemerkter den Platz füllt ...
Der Hinweis auf den "Kunstgriff des Dichters", der hier nur eben nicht vorliegen soll, könnte als Ironie verstanden werden, d.h. den Zweck haben, dem Leser die Erfundenheit
der ganzen Geschichte bewusst zu machen. Bei den Erzählern der Romantik - E.T.A. Hoffmann, Tieck, Eichendorff, Brentano - kommt diese Art 'romantischer Ironie' oft vor. Immer
wieder einmal stellen sich die Autoren neben ihre erfundenen Welten und wundern sich in Vertretung des 'günstigen Lesers' über den erstaunlich kunstähnlichen Verlauf.
Diese Art Ironie liegt hier aber doch noch nicht vor. Der Hinweis auf den "Kunstgriff" unterbricht die Illusion einer wirklichen Ereignisfolge nicht. Er wirkt eher so, als
müsse der Erzähler sich entschuldigen, dass sich die Wirklichkeit hier nach einem bekannten Erzählmuster richtet.
Zweites Kapitel
Aus Ottiliens Tagebuche
Es hat keinen Sinn, in diesen Aufzeichnungen die Gedanken einer Siebzehnjährigen entdecken zu wollen und sie auch noch zu der momentanen Situation der vorgeblichen Verfasserin
in Beziehung zu bringen. Im
VIERTEN KAPITEL versucht Goethe das Unvereinbare daran so zu erklären, dass Ottilie
manches woanders abgeschrieben haben müsste, doch auch das ist nur ein Notbehelf. Es sind eben einfach gedankliche Zutaten Goethes, die anders die Ereignisfolge wohl zu sehr unterbrochen hätten. Würden die sechs Tagebuchauszüge samt den Hinweisen auf sie in einer Ausgabe fehlen, würde sie wohl niemand vermissen oder den Roman weniger gut oder anders verstehen.
Die im fünften und sechsten Kapitel mitgeteilten Tagebuch-Einträge haben nach der Vermutung der Editoren von Goethes Maximen und Reflexionen (erstmals 1840 herausgegeben) überdies bei Abfassung des Romans bereits vorgelegen und wurden deshalb in diese Sammlung von Goethe-Sentenzen auch übernommen.
Erst recht unangebracht wäre es, dem Sachverhalt nachzugehen, dass es sich nur um '
ausgewählte Stellen' aus Ottilies Tagebuch handelt. In jüngeren Erzähltheorien wird großer Wert darauf gelegt, zwischen dem Autor und dem Erzähler zu unterscheiden. In diesem Fall könnte das die Frage nach sich ziehen, warum der Erzähler gerade die Partien weglässt, in denen sich Ottilie auf Tagesereignisse bezieht (siehe
ZWEITER TEIL, VIERTES KAPITEL). Sollte die Alltagsseite von Ottilies Weltsicht dem Leser verborgen bleiben? Jeder Einsichtige wird sich sagen, dass solche Überlegungen abwegig sind, weil Goethe die Tagebuch-Einträge auf eine Erzähler-Figur hin gar nicht kalkuliert hat.
Fünftes Kapitel

Was sollen wir noch viel von kleinen Nachstücken sagen, wozu man niederländische Wirtshaus- und
Jahrmarktsszenen gewählt hatte?
Solche Szenen als 'Nachstücke' zu nennen ist eine ziemlich sorglose erzählerische Ausflucht. Es hätte für diese Gesellschaft eher mehr als weniger Aufwand bedeutet, Volksszenen dieser Art glaubhaft nachzustellen. Die summarische Ergänzung macht aber klar, dass es gar nicht so einfach für Goethe war, bestimmte Bilder für diese Darbietungen zu benennen. Porträts waren ebenso wenig dafür geeignet wie Szenen großer Gesellschaften. Nur eigentlich Bilder im Kammerspiel-Format kamen in Frage. Es ist deshalb auch unangebracht, in den genannten Bildern nach weitreichenden Aussageabsichten zu suchen. Passende Szenen mit auch zumal jungen Frauen, für die sich jede Nacktheit aber verbot, hat es vermutlich gar nicht so viele gegeben. Das gilt erst recht, als Goethe sich nur auf seine eigene, begrenzte Kupferstichsammlung für sie stützen konnte.
Sechstes Kapitel

Eine der Töchter eines angesehenen Hauses hatte das Unglück gehabt, an dem Tode eines ihrer jüngeren
Geschwister schuld zu sein ...
Die Konstellation wiederholt sich in gewisser Weise in Ottilies Schuld am Tod des Kindes von Charlotte und hat auch bei ihr einen Rückzug aus der Gesellschaft zur Folge. Wenn Ottilie hier meint, "
dass bei einer konsequenten Behandlung die Kranke gewiss herzustellen gewesen wäre", so gilt das für sie jedoch nicht. Sie sieht sich nicht nur durch den Tod des Kindes belastet, sondern auch durch die Störung von Charlottes Ehe.
~~~~~~~~~~~~

Ottiliens Gestalt, Gebärde, Miene, Blick übertraf aber alles, was je ein Maler dargestellt hat.
Die Huldigung an Ottilies Erscheinung könnte größer nicht sein. Sie wirkt wie eine Heilige, soll geradezu eine Heilige sein, sodass die Herkunft der Figur aus der elsässischen Heiligen Odilie (siehe
ENTSTEHUNG), aber auch ihre Nähe zur Jungfrau Maria hier unübersehbar werden. Wie glaubhaft die Gloriole um sie letztlich ist, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dass ihr in ihrer Bescheidenheit der Eindruck, den sie macht, nicht ganz recht vorkommt, erhöht sie jedenfalls noch und kennzeichnet sie als ein Wesen von idealer Weiblichkeit.
Neuntes Kapitel

Nähmen wir uns aber zugleich die Mühe, aus den Briefen unserer Freunde eigentümliche Bemerkungen, originelle Ansichten, flüchtige geistreiche Worte auszuzeichnen ...
Diese Stelle macht besonders deutlich, wie wenig der Erzähler - Goethe - die Situation Ottilies bei diesem Tagebuch bedenkt. Es gibt keinen einzigen Hinweis in dem Roman, dass Ottilie Briefe empfängt, noch dazu solche, die geistreiche Ansichten enthalten könnten. Welche "Freunde" auch sollten sie ihr schreiben? Was kann sie dann aber veranlassen, über den Umgang mit einer solchen Korrespondenz nachzudenken und sich überdies vorzunehmen, in Zukunft sorgfältiger bei deren Aufbewahrung zu sein? Gedanken dieser Art kann sich nur jemand machen, der eine große Menge von Briefen schon empfangen hat und den nachlässigen Umgang mit ihnen mit zunehmendem Alter bedauert.
Zehntes Kapitel

»... dass man mir eine liebe Tasse zerbricht und es mir eine ganze Zeit aus keiner andern schmecken will.«
Eine Gewohnheit dieser Art hat sich auch schon für Eduard angedeutet. Im
SIEBZEHNTEN KAPITEL kommt sein Diener unter dem Vorwand in das Schloss zurück, er habe noch "eine Mundtasse des Herrn" für dessen Reise zu holen. Im
ZWEITEN TEIL, ACHTZEHNTES KAPITEL wird es das Glas von der Grundsteinlegung sein, an dem er hängt und nach dessen Verlust ihm kein Getränk mehr schmecken will. - Dass Alltagsgegenstände wie eine Tasse - das Glas hier ausgenommen - in diesem Luxusmilieu eine solche Bedeutung haben, ist nicht leicht nachzuvollziehen. Vielleicht ist es aber gerade die grenzenlose Verfügbarkeit solcher Gegenstände, die dem einen gewohnten Stück seinen Wert gibt.
~~~~~~~~~~~~

... und ahnete nicht, wie nahe diese seinen Zuhörern verwandt war.
Dass beide, Charlotte wie Ottilie, die Geschichte als eine des Hauptmanns kennen, wird nur hier angedeutet und ist deshalb vielleicht ein Versehen. Bei der geringen Bedeutung, die dieses frühere Vorkommnis für die Wahrnehmung des Hauptmanns hat, würde es aber auch keine Rolle spielen, wenn es anders wäre. Ottilie ist so sehr auf ihr eigenes Liebesproblem ausgerichtet, dass sie am Liebesschicksal des Hauptmann sowieso kein großes Interesse haben kann.
~~~~~~~~~~~~

Gönner und eigene Neigung bestimmten ihn zum Soldatenstande. Überall, wo er sich fand, war er geliebt und geehrt.
Dass der Nachbarssohn Soldat wird, könnte es nahe legen, in ihm den Hauptmann zu sehen. Dies ist aber gerade nicht so, weil er "Gönner" braucht, um dort
Fuß zu fassen. Von dem Hauptmann hingegen wird gesagt, dass er bereits als Jugendlicher mit Eduard gemeinsam in einer Pension erzogen wird, wo er offenbar eine ganz und gar adelsgemäße Erziehung erhalten hat. Eine Offizierskarriere stand ihm deshalb - wie Eduard - selbstverständlich offen (siehe
DRITTES KAPITEL).
~~~~~~~~~~~~

»Euren Segen!«, ertönte es zum dritten Mal, und wer hätte den versagen können!
Dass kein Wort über den düpierten Bräutigam fällt, ist schwer zu verstehen. Er hätte seinen Segen diesem Paar doch wohl versagen können.
Elftes Kapitel

... denn die Geschichte war ihr bekannt. Diese Begebenheit hatte sich mit dem Hauptmann und einer Nachbarin
wirklich zugetragen ...
An dieser Stelle wird mit dem Begriff der "Nachbarin" anscheinend eindeutig dem Hauptmann die Rolle des Retters und glücklichen Bräutigams zugewiesen,
denn der andere Bräutigam ist kein Nachbar des Mädchens gewesen. Das wirft allerdings die Frage auf, warum er dann unverheiratet geblieben ist. Oder hat
er geheiratet, wurde aber geschieden oder ist Witwer geworden? Eine so grundsätzliche Information sollte nicht unterblieben sein, wo doch von Eduard und
Charlotte die früheren Bindungsverhältnisse genau dargelegt werden. Da die Rettung des Mädchens für den Hauptmann mit einer
"
traurigen Erinnerung" verbunden ist, könnte das für ihn als Retter folglich nur
heißen, dass die Eltern sich der Heirat widersetzt haben. Wie jedoch ließe sich das mit dem Ausgang der 'Novelle' vereinbaren?
Die Geschichte geht viel plausibler auf, wenn man die Bezeichnung des Mädchens als "einer Nachbarin" nur als Namensersatz versteht und in dem Hauptmann
denjenigen sieht, der um sie geworben und sich mit ihr verlobt hat. Er hätte dann zu einer "traurigen Erinnerung" jeden Grund, weil die Fremdrettung
seiner Braut aus dem Wasser wirklich in seinem Leben "
auf die seltsamste Weise Epoche gemacht"
hätte. Seine umfassende Vorsorge gegen solche Unfälle beim Ausbau der Teiche, sein wie ein Akt der Selbstüberwindung geschilderter Heldensprung
zur Rettung des ertrinkenden Knaben ("
des Hauptmanns Entschluss war gefasst"), dazu die
Erwartungen Charlottes für ihn nach dieser Bewährung - alles das würde zu dem geübten Schwimmer und Lebensretter der 'Novelle' nicht passen.
Auch die ganze Sorge Charlottes um die Verheiratung des Hauptmanns wird erst verständlich, wenn man sie mit dem abrupten Verlust der Verlobten durch einen
anderen Mann in Verbindung bringt.

Ein wichtiges Indiz darüber hinaus ist noch, dass der neue Bewerber ein "
Mann von Stand" ist, also adlig. Das ergibt in seiner Betontheit nur einen Sinn, wenn es die "Nachbarin" und deren Jugendgefährte nicht sind. Der Hauptmann, unzweifelhaft von Adel, scheidet mithin als Jugendgefährte aus. Dass ihm als Bewerber auch noch "Vermögen und Bedeutung" nachgesagt werden, passt weniger gut, wäre in Absetzung von den bürgerlichen Verhältnissen des Mädchens jedoch nicht unangebracht. Außerdem ist der Hauptmann erst in jüngerer Zeit in seine "traurige Lage" geraten (siehe
LEBENSWELT zum
ERSTEN KAPITEL), sollte früher also besser gestellt gewesen sein.
~~~~~~~~~~~~

»... und hatte meine Freude an der Gewandtheit der schönen Schifferin. Ich versicherte ihr, dass ich seit der Schweiz, wo auch die reizendsten
Mädchen die Stelle des Fährmanns vertreten, nicht so angenehm sei über die Wellen geschaukelt worden.«
Hier wird nach der Mitteilung von ihren Kahnfahrten im
SIEBZEHNTEN KAPITEL ein weiteres Mal
gesagt, wie gut Ottilie mit dem Ruderboot umgehen kann. Um so verwunderlicher ist es folglich, dass sie bei der Überfahrt mit dem Kind alles verkehrt macht.
Zwölftes Kapitel

Vor allen Dingen berief er den Major. Die Freude des Wiedersehens war groß.
Es ist etwas irritierend, dass der Freund, der bisher immer nur 'der Hauptmann' war, jetzt 'der Major' ist. Seine Beförderung wird im
VIERZEHNTEN KAPITEL angekündigt, kurz bevor er Eduard und Charlotte verlässt. Dass er stets nur mit seinem militärischen Dienstrang und nicht Otto genannt wird, wie er ja heißt (siehe
DRITTES KAPITEL), hat sicherlich keinen anderen Grund als den, ihn dem Leser besser unterscheidbar zu machen. Von Eduard, der auch einen hohen militärischen Rang innehaben muss, wird dieser Rang ja noch nicht einmal mitgeteilt. Dennoch wertet ihn der Namentausch ab, da so der Eindruck entsteht, als komme es für ihn ausschließlich auf seinen Dienstgrad an. Selbst zur Goethezeit kann das keine Empfehlung gewesen sein.
Immerhin wird die neue Rangstellung in allen weiteren Zusammenhängen konsequent benutzt. Ähnelt bis zu diesem Zeitpunkt das Kind von Charlotte "
immer mehr dem Hauptmann", so ruft Eduard jetzt bei dessen Anblick aus: "
Ist dies nicht die Bildung des Majors?". Auch in der Begegnung mit Charlotte wird er stets mit dem neuen Rangnamen belegt.
Dreizehntes Kapitel

... so liebenswürdig anzusehen, dass die Bäume, die Sträuche ringsumher hätten belebt, mit Augen begabt sein sollen, um sie zu bewundern ...
Was diese Bewertung bezweckt, ist offensichtlich: nichts an Ottilie soll sie nachlässig, fahrlässig, schuldig an der Situation erscheinen lassen, die aus dem selbstvergessenen
Lesen entsteht. Doch dafür die Bäume und Sträucher zu bemühen, ist unrichtig, es ist unecht, es ist Kitsch. Der gefällige Eindruck soll den Unschuldsbeweis ersetzen,
und das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Müsste man erfahren, welchen Geschichten, welchen Situationen sich Ottilie bei ihrer Lektüre in Gedanken zuwendet, bliebe von der Aura des Bewundernswerten nichts übrig. Man würde sie in einen Abgrund von Trivialität versunken sehen.
~~~~~~~~~~~~

Sie reißt ihren Busen auf und zeigt ihn zum ersten Mal dem freien Himmel ... hebt das erstarrte Kind mit beiden Armen über ihre unschuldige Brust, die an Weiße und leider auch an Kälte dem Marmor gleicht.
Man kann es nicht anders sagen: die ganze Beschreibung ist eine einzige voyeuristische Geschmacklosigkeit. Es geht um ein ertrunkenes Kind, ein verzweifeltes Mädchen, und die Schilderung ergötzt sich an deren entblößter Brust.
Vierzehntes Kapitel

»Und für mich, was darf ich hoffen?«, lispelte er leise. - »Lassen Sie mich Ihnen die Antwort schuldig bleiben«, versetzte Charlotte. »Wir haben nicht
verschuldet, unglücklich zu werden, aber auch nicht verdient, zusammen glücklich zu sein.«
Charlottes karge Antwort verdeckt das logische Problem, in das Goethe seine Figur hier hineinmanövriert hat. Wenn Charlotte dem Schicksal zugesteht, dass es ihren eigenen Wunsch und Vorsatz, Eduard mit Ottilie zu verbinden, mit der ihr abverlangten Scheidung "wieder in den Weg bringen" wollte - warum fasst sie es nicht auch als einen Schicksalswink auf, dass sie jetzt den Major heiraten kann? Da Goethe einen solchen Ausgang sicherlich nie erwogen hat, schon eine Komplikation in dieser Richtung nicht, weil Ottilies kategorische Ablehnung der Scheidung dann Charlotte ja geradezu brüskieren würde, bleibt ihm an dieser Stelle nur übrig, seine Figur und auch sich selbst mit einem ebenso kategorischen wie dunklen Satz aus der Affäre zu ziehen.
~~~~~~~~~~~~

»Zum zweiten Mal«, so begann das herrliche Kind mit einem unüberwindlichen, anmutigen Ernst ...
Ottilie hier als "das herrliche Kind" bezeichnet zu sehen, ist doch etwas sonderbar, schließlich hat ihre Unbedachtheit den Tod eines Kindes nach sich gezogen.

Du sagtest mir einst, es begegne den Menschen in ihrem Leben oft Ähnliches auf ähnliche
Weise und immer in bedeutenden Augenblicken.
Dass Ottilie Charlotte hier duzt, soll ihre sittliche Ebenbürtigkeit dieser gegenüber anzeigen. In allen früheren Gesprächen redet sie Charlotte mit 'Sie' an (siehe
SECHSTES KAPITEL) und auch danach geht sie zu dieser Anredeform wieder über (siehe
ZWEITER TEIL, FÜNFZEHNTES KAPITEL).
Fünfzehntes Kapitel

Sie unterhielt, sie zerstreute Charlotten, die noch immer die stille Hoffnung nährte, ein ihr so wertes Paar verbunden zu sehen.
Die freundlichen Gefühle, die Charlotte hier für Ottilie, das "himmlische Kind", zugesprochen werden, vermag man kaum zu glauben. Ottilie hat sich
hinter ihrem Rücken mit ihrem Mann auf die Scheidung verständigt, und sie hat darüber hinaus entgegen ihrer "
Besorgnis"
das Kind mit zur Überfahrt in das Boot genommen - wie kann sie da so eine Großmut an den Tag legen? Ihre in Wahrheit ganz anderen Empfindungen könnten angedeutet sein,
wenn sie

verschiedentlich, obgleich auf das Leiseste, angeforscht, ob nicht eine Annäherung Ottiliens zu Eduard denkbar sei ...
Denn warum ist ihr das zu wissen wichtig, wenn sie doch vor allem wünscht, diese Verbindung herbeizuführen? Wäre es da nicht richtiger, für die eine und andere
Begegnung zu sorgen, Eduard wieder ins Haus zu bitten, die Dinge in Ruhe sich entwickeln zu lassen? Tatsächlich tut sie das Gegenteil. Mit der Begründung, Ottilie einen
"Zwiespalt im Gemüt" ersparen zu wollen, nimmt sie ihr das förmliche Versprechen ab, Eduard ein für allemal zu entsagen:

»... Hast du dich aber hierzu bestimmt, so schließen wir einen Bund, dass du dich mit ihm nicht einlassen willst, selbst nicht in eine Unterredung, wenn er dich
aufsuchen, wenn er sich zu dir drängen sollte.«
Weist sich darin nicht klar aus, dass sie Ottilie die glückliche Vereinigung mit Eduard nicht gönnt? Und zeigt sich nicht obendrein, dass sie deren Festigkeit misstraut,
wenn es anschließend heißt:

Nun aber schwebte Charlotten immer noch jene Drohung Eduards vor der Seele, dass er Ottilien nur so lange entsagen könne, als sie sich von Charlotten nicht trennte.
Während der Erzähler sich in anderen Fällen mit Charlottes Innenleben auskennt, endet seine Kennzeichnung hier in dem klaren Widerspruch, dass Charlotte zunächst die "stille
Hoffnung" hat, Ottilie und Eduard verbunden zu sehen, nun ihr aber die "Drohung Eduards" vor der Seele steht, die Verbindung käme zustande, falls sie Ottilie wegschicken würde.
Sechzehntes Kapitel

An meine Brust, Ottilie! Hieher, wo du manchmal geruht hast und wo du immer hingehörst!
Für die erste Lesergeneration war das ein eindeutiger Hinweis darauf, dass es zwischen Eduard und Ottilie auch zu einer sexuellen Beziehung gekommen ist, so wenig der Geschehensablauf des ersten Handlungsteiles dafür einen Anhaltspunkt bietet. Denn wenn der Abend des Feuerwerks als die Ankündigung einer solchen Beziehung aufgefasst werden kann (siehe unter
GESTALTUNG zum
FÜNFZEHNTEN KAPITEL), so reist Eduard doch schon am nächsten Tag aus dem Schloss ab. 'Manchmal' könnte also höchstens einmal sein. Dennoch ist diese Andeutung zumal für die frühen Leserinnen Anlass zu einer massiven Verurteilung Ottilies gewesen. Dass sie sich im Haus des verheirateten Eduard mit diesem auf eine solche Beziehung eingelassen hat, macht vielen von ihnen die ganze Aura von Edelsinn, mit der sie umgeben ist, unglaubhaft. Ob Goethe das "manchmal geruht" wirklich so weitgehend verstanden wissen wollte, muss offen bleiben.
~~~~~~~~~~~~

... dann drückte sie die flachen, in die Höhe gehobenen Hände zusammen, führte sie gegen die Brust, indem sie sich nur wenig vorwärts neigte, und sah den
dringend Fordernden mit einem solchen Blick an, dass er von allem abzustehen genötigt war ...
Hier wird nahezu wörtlich aufgenommen, was im
FÜNFTEN KAPITEL der Gehilfe aus der Pension an Charlotte schreibt,
verbunden mit der Bitte, bei einer solchen Geste Ottilie auf keinen Fall weiter zu bedrängen.
~~~~~~~~~~~~

Eduard im tiefsten Kummer warf sich auf Ottiliens Schwelle, die er mit seinen Tränen benetzte. Jammervoller brachten kaum jemals in solcher
Nähe Liebende eine Nacht zu.
Das Pathetische dieser Formulierung hört sich heute so sehr nach Trivialliteratur an, dass es schwer fällt, in ihr noch etwas aufrichtig Gemeintes wahrzunehmen. Es ist dies
aber nicht das einzige Mal, dass Goethe für einen Moment höchster Anteilnahme zu einer solchen floskelhaften Großspurigkeit greift.
~~~~~~~~~~~~

Aber als er fragt, ob er sie zu Charlotten zurückführen dürfe, bejaht sie's ...
Was Ottilie veranlasst, die Reise in die Pension aufzugeben, wo sie doch gerade erfahren hat, in welche Not sie eine Begegnung mit Eduard bringt, ist nicht zu verstehen.
Alles soll eben auf das vorgesehene Ende zulaufen, auf die Wahrscheinlichkeit der Vorgänge wird nicht mehr so geachtet. Ohnehin entzieht sich Ottilies Verhalten
immer mehr der rationalen Erschließbarkeit, da kommt es auch auf ihre Gründe für diese Rückkehr nicht mehr an.
Siebzehntes Kapitel

Sie wohnten unter einem Dache; aber selbst ohne gerade aneinander zu denken ... näherten sie sich einander. Fanden sie sich in einem Saale, so dauerte
es nicht lange, und sie standen, sie saßen nebeneinander.
Dies ist die deutlichste Bestätigung der tatsächlich naturverhängten 'Wahlverwandtschaft' zwischen Eduard und Ottilie. Wie in dem Beispiel
der chemischen Stoffe, die gar nicht anders können, als miteinander zu reagieren (siehe
ERSTER TEIL, VIERTES KAPITEL),
fühlen sich auch diese beiden unabweislich zueinander hingezogen. Das menschliche Sittengesetz, das ihre Verbindung nicht erlauben will, nimmt ihnen buchstäblich das Leben.
~~~~~~~~~~~~

... sie hatte dem Gärtner angedeutet, die Sommergewächse aller Art zu schonen, und sich besonders bei den Astern aufgehalten, die gerade dieses Jahr in unmäßiger Menge blühten.
Ottilie sieht ihren Tod offenbar voraus und denkt bereits an ihre Beerdigung - man wird der Toten "
einen Kranz von Asterblumen" aufsetzen.
Achtzehntes Kapitel

... fiel die Sorge, die geliebten Reste zu bestatten, Charlotten anheim ...
geliebte Reste: ein unerwartet nüchterner Ausdruck, wo doch andererseits von einem "
holden Körper"
gesprochen wird, ja Ottilie als Tote gar "
vollständiger, schöner als alle" aussieht. Soll Charlotte damit
als weniger teilnehmend gekennzeichnet werden? Dass sie trauert, wird jedenfalls nicht ein einziges Mal gesagt, nur ihre Verfügungen für die Beisetzung in der Kapelle
kommen noch zur Sprache.
~~~~~~~~~~~~

Schon einmal hatte er so vor Belisar gestanden. Unwillkürlich geriet er jetzt in die gleiche Stellung; und wie natürlich war sie auch diesmal!
Die Rückbindung der Situation an die Aufführung der 'Lebenden Bilder' (siehe
FÜNFTES KAPITEL)
muss hier eigens erläutert werden, weil der betreffende Moment für das Gesamtgeschehen ganz nebensächlich ist und zumal für das Verhältnis des Architekten
zu Ottilie überhaupt nichts besagt. Sie war an der Bilddarstellung noch nicht einmal beteiligt. So hat es etwas gezwungen Rhetorisches, wenn hier nur wegen der natürlichen Haltung
des Architekten beim Trauern um Ottilie an Belisar erinnert wird. Tatsächlich kann kein einziger Zug angeführt werden, in dem die verstorbene Ottilie dem blinden Belisar gleicht.
Und möchte man wirklich von dem Architekten erfahren, dass er ein vorzüglicher Trauer-Darsteller ist?
~~~~~~~~~~~~

Denn eines Tages, als Eduard das geliebte Glas zum Munde brachte, entfernte er es mit Entsetzen wieder; es war
dasselbe und nicht dasselbe ...
Dass das für so bedeutsam gehaltene Glas mit den Anfangsbuchstaben E und O (siehe
ERSTER TEIL, NEUNTES KAPITEL) zerbrochen ist, bestätigt
eigentlich die Gültigkeit seines Zeichenwertes. Eduard hat sich nur zunächst täuschen lassen, so wie er sich selbst über die Möglichkeit einer Verbindung
mit Ottilie getäuscht hat.
~~~~~~~~~~~~

... aus einer Brieftasche ausgebreitet: eine Locke, Blumen, in glücklicher Stunde gepflückt, alle Blättchen, die sie ihm geschrieben, von jenem ersten an, das ihm seine
Gattin so zufällig ahnungsreich übergeben hatte.
Das erste Zettelchen Ottilies ist eine Erwiderung auf seinen Wunsch, sich heimlich gegenseitig zu schreiben (siehe
ERSTER TEIL, DREIZEHNTES KAPITEL).
Im Übrigen bewahrt Eduard die gleichen Erinnerungsstücke auf wie Ottilie, denn auch bei ihr sind es "kleine Zettelchen und Briefe Eduards, mancherlei aufgetrocknete Blumenerinnerungen früherer
Spaziergänge, eine Locke ihres Geliebten" (siehe
ACHTZEHNTES KAPITEL).