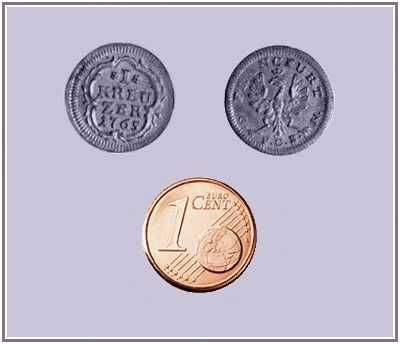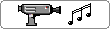{VORREDE}
Die starke Flexion des Eigennamens - 'des Werthers' - war zum Zeitpunkt
der Erstveröffentlichung des Romans zwar noch üblich, kam in den nachfolgenden
Jahrzehnten aber mehr und mehr außer Gebrauch. Schon in der Cottaischen Ausgabe
von Goethes Schriften Bd. 11 (Tübingen 1808) wurde deshalb in der Vorrede von
der "Geschichte des armen WertheR" gesprochen, während - vermutlich wegen
eines Versehens - der Titel selbst auf "Leiden des jungen WertheRS" lautete.
Für die Ausgabe, die Weygand 1825 zum fünfzigjährigen Jubiläum
der Erstausgabe herausbrachte, wurde dann aber "Die Leiden des jungen WertheR" verwendet.
In dieser Form hat den Titel auch die Sophienausgabe übernommen, obwohl die
Ausgabe Letzter Hand (Cotta 1830) wiederum 'WertheRS' benutzt. Da Goethe in der
Fassung von 1787 zudem auf den bestimmten Artikel verzichtete und der Titel nur
"Leiden des jungen Werthers" lautete, kommen nebeneinander vor: "Die Leiden
des jungen Werthers", "Leiden des jungen Werthers" und "Die Leiden des jungen
Werther".
Darüber hinaus ist aus heutiger Sicht auffällig,
dass Werther keinen Vornamen hat.
Selbst im privatesten Gespräch mit Lotte wird er von ihr nur
'Werther' genannt, obwohl er seinerseits sie 'Lotte' nennt und
auch Albert und Wilhelm nur mit Vornamen angeredet werden bzw. nur
mit Vornamen vorkommen. Tatsächlich war jedoch gerade der Gebrauch der
Vornamen - jedenfalls für Männer - damals unüblich, und zumal Goethe hat sich
auch von engen Freunden nie anders als mit dem Zunamen anreden
lassen. Auch hat er seine Briefe nie anders als mit G. oder Goethe
unterzeichnet, nicht einmal die an Christiane Vulpius,
die Mutter seines Sohnes und seine spätere Frau. Dass Albert und Wilhelm
Vornamens-Personen sind, hat aber sicherlich weiter keine Bedeutung, sondern
dient nur der bequemeren Merkbarkeit.
~~~~~~~~~~~~
Der Name Werther stammt aus dem Niederrheinischen und ist nicht besonders
selten. Er leitet sich von 'Werder'=Insel ab und kommt auch in den Formen
Werth, Werthmann, Wertheim usw. vor.
Am 4. Mai 1771.
"Wissenschaftlicher Gärtner" bezieht sich auf die französische
Gartenkunst mit ihren geometrischen Anlagen, während es sich hier um
einen 'englischen Garten' handelt, für den ein mehr natürlicher Eindruck
angestrebt wurde. Die sehr genau bedachte Gestaltung solcher Gärten
erforderte allerdings kaum weniger 'Wissenschaft' als der französische Typus.
Am 10. Mai.
Am 12. Mai.
Dass das Wasser aus Brunnen geschöpft und in die Häuser getragen werden musste,
war in Deutschland bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Regel. Wer es sich
leisten konnte, nahm Wasserträger in Anspruch, und in größeren Städten wurde
Wasser auch mit Fuhrwerken ausgefahren. Erst das rapide Wachstum der Städte
von der Jahrhundertmitte an zwang zum Bau von Wasserleitungen, die innerhalb
weniger Jahrzehnte dann aber überall entstanden. -
Wetzlar zur Goethezeit bezog sein Wasser hauptsächlich aus Quellen südlich vor der Stadt,
aus dem Kaisersgrund; es wurde von dort in Holzröhren in vier innerstädtische Brunnen
- sogenannte Laufbrunnen - geleitet. Der Brunnen vor dem Wöllbacher Tor war von dieser
Versorgung aber unabhängig, er speiste sich unmittelbar aus einer Quelle des Lahnberges.
Als Wetzlar zu Ende des 19. Jahrhunderts eine moderne Wasserversorgung bekam und diese
Quelle auch versiegt war, schloss man den mittlerweile so benannten Goethebrunnen an
das städtische Leitungsnetz an.
~~~~~~~~~~~~
'Anzüglich' meint hier "anziehend". In der Bedeutung der 'anzüglichen' Rede
kam das Wort aber auch zur Goethezeit schon vor.
Am 13. Mai.
Am 15. Mai.
Werthers Äußerungen einerseits über die "geringen Leute", andererseits
über "Leute von einigem Stand" machen seine soziale Mittelstellung deutlich.
Er gehört dem wohlhabenden und gebildeten Bürgertum an und ist sich seines
Abstandes zum Volk, dem 'sogenannten Pöbel', durchaus bewusst. Der Gedanke,
sich vor diesem auszeichnen und bewähren zu müssen, ist ihm jedoch ganz
selbstverständlich - Standesdünkel, wie er ihn im Adel findet
(siehe unter
dem Brief vom 15. März 1772)
lehnt er ab. Allerdings hängt auch sein eigener Aufstieg (in die Schicht des Adels)
allein von seiner Tüchtigkeit ab, so wenig ihm an diesem Aufstieg zuletzt liegt.
Noch mehr als gegen den Adel richtet sich seine Kritik allerdings gegen die
Angehörigen seines eigenen Standes. "Hier grenzt er sich mit wachsender Schärfe ab -
gegen das Spießbürgertum, gegen den 'Philister', gegen bürgerlichen Dünkel, gegen
Opportunismus und 'Rangsucht' oder dagegen, sich vor dem Adel zu 'prostituieren'.
Er ist empfindlich und überempfindlich wie nur einer, der innerhalb derselben
Bezugsgruppe seinen besonderen Platz erst noch sucht."
Den 17. Mai.
Am 22. Mai.
Am 26. Mai.
Am 27. Mai.
Werther ist mit dem Geschenk eines Kreuzers an jedes der Kinder durchaus großzügig.
60 Kreuzer ergaben einen Gulden und mithin schon eine Summe, die etwa dem Tagesbedarf
einer mehrköpfigen bürgerlichen Familie entsprach. - Für einen Kreuzer
erhielt man nach der Taxordnung von Wetzlar aus dem Jahre 1767 zwei Eier oder einen
Milchweck (=Milchbrötchen) von sieben Lot (etwa 100 Gramm).
Am 30. Mai.
Am 16. Junius.
Menuett = Das Menuett (ursprünglich: die Menuet), ein im 17. Jahrhundert in Frankreich
aufgekommener Gesellschaftstanz in langsamem Dreivierteltakt, stand regelmäßig am
Anfang eines Tanzabends. Nach unseren Begriffen handelte es sich dabei allerdings weniger
um einen Tanz als um eine Tanzvorführung, da immer nur ein Paar tanzte und danach zur Seite
trat, um dem nächsten Paar Platz zu machen. Die einzelne Tanzsequenz dauerte nur zwischen
einer und zwei Minuten, konnte allerdings auf Wunsch der Dame auch variiert und verlängert
werden. Das Paar verneigte sich zunächst vor den Anwesenden und absolvierte
dann teils neben-, teils miteinander verschiedene Figuren, bei denen es hauptsächlich
auf die zierliche Setzung der Füße, elegante Verbeugungen und Knickse und ein gefälliges
Durchschreiten der Tanzfläche ankam. Die intimste Geste war, dass man sich ab und zu bei
den Händen fasste und umeinander drehte.
Der Vorschrift nach musste sich das Paar beim Menuett so bewegen, dass die
Schrittfolge auf der Tanzfläche ein "Z" oder umgekehrtes "S" ergab. Die Schilderung
Werthers lässt allerdings zweifelhaft erscheinen, ob man sich hier noch genau
nach der Vorschrift richtet.
Englischer = Der englische Tanz, auch Contretanz genannt, wurde im 17. Jh. in Frankreich
aus der Nachahmung englischer Volkstänze entwickelt (deshalb ursprünglich "Country Dance").
Er folgte bei Tanzabenden dem Menuett, hat einen lebhaften Zweivierteltakt und wird in Gruppe getanzt.
Vier, sechs oder acht Paare bilden zunächst einen Kreis und springen einige Takte links,
einige rechts herum. Danach stellen sie sich in Reihe oder im Karree gegenüber auf, tanzen
aufeinander zu und wieder zurück, wechseln über Kreuz die Partner, bilden einen äußeren und
einen inneren Kreis und gehen gegenläufig umeinandner herum usw. Der Contretanz hat
eine recht komplizierte, immer wieder variierbare Choreographie und erforderte deshalb einen
Tanzmeister, der den Tänzern die jeweiligen Figuren ansagte.
Deutscher = Der deutsche Tanz, das 'Walzen', entsprach schon ziemlich dem heute noch
getanzten Wiener Walzer, wenn schon das Tempo noch geringer war und auch der 'Deutsche'
noch in einer Gruppe getanzt wurde. Die Paare stellten sich im Kreis auf und drehten
sich zu zwei Dreiviertel-Takten jeweils einmal um sich selbst, während sich alle
gleichzeitig auf dem Kreisbogen ein Stück weiter bewegten. Der Herr fasste die
Dame dabei um die Taille und sie legte ihm die Hände auf die Schultern. Die
Linksdrehung der Paare bei gleichzeitiger Linksdrehung des Paarkreises ergab ein
beschwingtes Gesamtbild, konnte aber auch schon, da die Paare sich nicht trennten,
als individuelles Tanzen verstanden werden. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts wurde
auf die Kreisbildung mehr und mehr verzichtet und jedes Paar suchte sich bei seinen
Drehungen auf der Tanzfläche seinen eigenen Weg. Zugleich ging man zu der noch
heute üblichen Tanzhaltung mit dem einem abgestreckten Armpaar über.
Welche Sinnlichkeit in diese Art zu tanzen hineingelegt wurde, zeigt das Urteil
der 19jährigen Pauline Fürstin zur Lippe (späterer Regentin von Lippe-Detmold),
die 1788 über den "frechen, sittenlosen Tanz der Deutschen" schreibt:
Ein Frauenzimmer, das diesen gern und lange, oft mit einem ihr nicht unangenehmen Liebhaber tanzt,
geb' ich schon halb verlohren; denn, mit welchem Muth wird sie dem Manne Etwas
versagen, der sie im Augenblick vorher an sein laut klopfendes Herz drückte, dessen
Arme voll kochenden Bluts sie fest umfaßten und wild im rauschen Wirbeltanz dreheten,
der seine glühende Wange auf ihr brennendes Angesicht drückte, und ihr so viel Küsse
rauben konnte, als er wollte - Sie wird Dem, ... in dessen Umschlingungen sie sich
wonnetrunken im Taumel der Lust verlohr, wo so leicht jede ernste Empfindung vom Rausch
der Sinnlichkeit überwältigt und alles edlere Gefühl der weiblichen Würde so leicht
weg geschwärmt wird - o sie wird ihm nicht lange widerstreben und - selbst das Opfer
seyn in dem Augenblick, da sie von einem Andern Opfer zu empfangen glaubte.
Ein ähnliches Urteil trifft 1832 in seinem "Demokritos" auch noch Karl Julius Weber (1767-1832):
Wenn das Paar sich eng umschlingt, Knie an Knie, Brust an Brust, Aug in Auge, die Hand des
Mädchens auf der Schulter des Jünglings, und die seinige noch traulicher auf schwellenden runden
Hüften, wenn der reine Athem der Schönen anweht, wenn man an den heißen Wangen die Wärme fühlt und
ein Herz dem andern entgegenklopft, muss da nicht Phantasie und Sinnlichkeit rege werden?
"... mein Chapeau walzt schlecht ..." Frz. chapeau heißt eigentlich Hut, hier in der
Bedeutung von Tänzer, weil die Herren beim Menuett in zeremonieller Weise einen
Hut auf- und abzusetzen hatten.
Am 19. Junius.
Eine Rückfahrt bei Sonnenaufgang bedeutet für Wetzlar Mitte Juni eine
Zeit morgens gegen vier Uhr. (Nach Ortszeit, also dem tatsächlichen
Sonnendurchgang, nach dem man damals die Uhren noch gestellt hat, geht die Sonne
in Wetzlar am 15. Juni gegen 3.40 Uhr auf.) Da die Hinfahrt bei
Sonnenuntergang stattfindet - Mitte Juni nach Ortszeit 20.10 Uhr -,
dauert der Ball immerhin sieben Stunden.
Am 21. Junius.
Ein bemerkenswertes Detail ist, dass man sich damals in Wirtshäusern
seine Mahlzeit noch selbst zubereiten konnte oder die Zutaten zur
Zubereitung mitbrachte. Bei Ausflugslokalen gab es das noch bis in die
Zeit um den Zweiten Weltkrieg. "Hier können Familien Kaffee kochen!",
hieß es da auf Schildern, ein Angebot an ärmere Familien, sich für
ein paar Groschen eine mitgebrachte Kaffeemahlzeit selbst zubereiten zu können.
Am 29. Junius.
Am 1. Julius.
Quakelchen = "Quacker" war nach Frankfurter
Umgangssprache der Kosename für einen kleinen Jungen,
also als Liebling, Herzblatt, Sonnenschein usw.
zu verstehen.
böser Humor = schlechte Laune
Vikar = Hilfspfarrer, Anwärter auf eine Pfarrstelle
~~~~~~~~~~~~
Die Pfarrhaus-Szenerie gibt ein aufschlussreiches Bild
von der damaligen Wahrnehmung der Lebensalters-Stufen. Der Pfarrer
hat vor 27 Jahren als armer Student seine jetzt 50jährige
Frau kennengelernt, er ist also sicherlich noch nicht
älter als Mitte fünfzig. Wahrgenommen aber wird er als "der Alte",
geht auch bereits am Stock und ist an seinem Lebensabend angekommen.
(Im Brief vom 15. September 1772 wird dann mitgeteilt, er sei bereits gestorben.)
Seine Tochter ist verlobt und wird heiraten, doch hat er zugleich noch
einen Sohn von vier oder fünf Jahren, das 'Quakelchen' seines Alters.
So überschneiden sich zur damaligen Zeit die Generationen,
zwischen dem ältesten und dem jüngsten Kind eines Ehepaares konnte
leicht ein Altersabstand von 20 Jahren bestehen.
Bemerkenswert ist auch noch, dass der Pfarrer sich vornimmt, im nächsten
Jahr zu einer Kur nach Karlsbad zu fahren. Dass dies sowohl als
Behandlungsform wie auch den materiellen Möglichkeiten nach
für einen Dorfpfarrer in Betracht kommt, würde man so leicht
für diese Zeit nicht vermuten.
Am 6. Julius.
Kleine Mädchen zu warnen, sich nicht von fremden Männern küssen
zu lassen, weil ihnen dann ein Bart wachse, ist zweifellos ein zu
ihrem Schutz erfundenes Märchen - sie sollten Intimitäten mit
fremden Männern eben aus dem Wege gehen. Wenn der Vater des neugeborenen
Kindes diesem Märchen gut aufklärerisch widerspricht, zeigt das
nur, dass er den tieferen Sinn des Ratschlages - ebenso wie Werther oder Goethe - nicht
mehr wahrnimmt.
Am 8. Julius.
Am 10. Julius.
Am 11. Julius.
'Gulden' war im 18. Jahrhundert in Deutschland sowohl Münze wie
Rechnungseinheit und bedeutete eine Münze mit einem Silberanteil von
ca. 13 Gramm (Raugewicht ca. 15 Gramm), nämlich 20 Stück aus
der feinen Mark, die im 18. Jahrhundert einem Silbergewicht von ca. 260
Gramm entsprach. Auch halbe oder Zwei-Drittel-Taler mit diesem Gewicht
wurden deshalb als Gulden bezeichnet.
Am 13. Julius.
Am 16. Julius.
Das häusliche Klavierspiel im 18. Jahrhundert fand noch nicht
auf dem uns bekannten Hammerklavier (auch Pianoforte genannt) statt,
sondern auf dem kleineren Klavichord. Die Saiten wurden bei diesem
Instrument durch Eisenstifte zum Klingen gebracht, weshalb Ton und
Lautstärke durch den Anschlag noch kaum moduliert werden konnten
(Beispiele unter siehe unter
ZITATE).
Wie solche Instrumente aussahen, ist auf den Illustrationen zum 'Werther' zu sehen
(siehe die
ILLUSTRATIONEN zum
Brief vom 4. Dezember 1772).
Die Hammerklaviere des 18. Jahrhunderts waren noch große liegende Kästen,
also Vorformen des Flügels, während das Klavier mit senkrecht
stehendem Kasten erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts aufkam.
Am 18. Julius.
Auch wenn das Wort von den 'tausend Talern' nur eine Redewendung ist -
es handelt sich dabei um eine durchaus kalkulierbare Summe. Der
Konventionstaler war eine Silbermünze im Raugewicht (Silberanteil
900/1000) von ca. 29 Gramm, d.h. er enthielt ca. 26 Gramm reines Silber.
(Die reichseinheitlich gewichtete 'Mark' bedeutete im 18. Jahrhundert ca. 260
Gramm Silber.) Bei eintausend Talern wären also 26 kg Silber zusammengekommen
- schon 10% mehr als die Menge, die Goethe bei seinem Amtsantritt in Weimar 1776
als Jahresgehalt erhielt (nämlich 1200 Reichstaler; der Reichstaler war
mit ca. 21 Gramm ein Viertel weniger wert als der Konventionstaler). Zehn Jahre
später betrug Goethes Gehalt allerdings schon das Doppelte.
"Bononischer Stein" = Bologneser Schwerspat, ein fluoreszierender Stein,
von dem Goethe in seiner "Italienischen Reise" (1816) mitteilt, er werde zu
'kleinen Kuchen' verarbeitet, die "im Dunkeln leuchten, wenn sie vorher
dem Lichte ausgesetzt gewesen, und die man hier kurz und gut Fosfori nennt."
(Eintrag zum 20. Okober 1786)
~~~~~~~~~~~~
Surtout = frz. Mantel, Umhang ('über alles')
Den 19. Julius.
Den 20. Julius.
Subordination = Unterordnung.
Am 24. Julius.
prostituiert = sich bloßgestellt; als Begriff für das
Sich-bloß-Stellen von Frauen erst im späten 19. Jahrhundert
aufgekommen, weil ältere Begriffe wie 'Hurerei' oder 'Dirnenwesen'
nicht mehr gesellschaftfähig waren.
Am 26. Julius.
Man hatte zu jener Zeit noch keine Löschblätter, sondern gebrauchte Sand
zum Abtrocknen der Tinte. Er wurde aus einer Art Salzstreuer über das Blatt
gestreut und anschließend - blaugefärbt - in ein Gefäß geschüttet oder weggeblasen.
Leicht konnten aber Sandkörnchen an dem Blatt kleben bleiben.
Am 30. Julius.
so ehrlich = so ehrenhaft, so anständig
Prätension = Ansprüche
Strohmänner = Strohpuppen, also nicht
in der heutigen Bedeutung von 'Ersatzmännern' zu verstehen.
Am 8. August.
Am 10. August.
Am 12. August.
Terzerol (Italienisch: terzeruolo = Habicht) bezeichnet keine bestimmte
Waffenart, sondern nur allgemein eine kleine Pistole für den privaten
Gebrauch. Im 18. Jahrhundert waren das Steinschloss-Pistolen, so genannt
nach dem Feuerstein (Schwefelkies), der in eine Art Schraubstock
geklemmt wurde und beim Aufschlagen den Zündfunken erzeugte. Das Laden
der Waffe war umständlich. Zunächst wurde über die vordere Rohröffnung
das Pulver eingefüllt, dann mit dem Ladestock die Kugel nachgeschoben
und schließlich auf die außen liegende Pfanne eine kleine Menge Pulver
für die Zündung gegeben. Die Pfanne wurde mit einem Deckel, an dem sich
zugleich die Schlagfläche befand, abgedeckt (das Teil im ganzen hieß
'Batterie', nach franz. battre = schlagen). Beim Auslösen entzündete
der geschlagene Funke das Pulver auf der Pfanne, und über ein seitliches
kleines Loch fuhr die Flamme in das Rohr, wo sie wiederum das Pulver dort
zur Zündung brachte. Steckte statt der Kugel der Ladestock im Rohr,
wurde er ebenfalls wie ein Geschoss herausgetrieben.
~~~~~~~~~~~~
Gewehr = hier allgemein im Sinne von 'Waffe'.
~~~~~~~~~~~~ |
|
Die Funktionsweise eines Steinschlosses (nach Heinrich Müller: Gewehre -
Pistolen - Revolver. Leipzig 1979. S. 123)
|
Das Steinschloss war von der Mitte des 17. bis zum frühen 19. Jahrhundert
der für Handfeuerwaffen übliche Mechanismus. Es wurde durch das
Perkussionsschloss abgelöst, bei dem neue Zündmittel durch einen Schlag
entflammt wurden, so dass die Zündung im Inneren des Rohres stattfinden konnte.
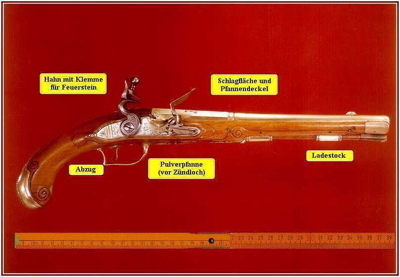 |
|
Ein Terzerol mit Steinschloss aus der Zeit um 1770, Kaliber 12 mm. (Waffenmuseum Suhl/Thüringen)
|
Am 15. August.
Inzidentpunkt = juristischer Fachausdruck für einen (strittigen) Begleitumstand
Am 18. August.
Am 21. August.
Am 22. August.
Am 28. August.
Am 30. August.
Am 3. September.
Am 10. September.
sympathetisch = gemeinsam empfindend, Modewort gegenüber dem schlichteren 'sympathisch'
Am 20. Oktober 1771.
Am 26. November 1771.
Am 24. Dezember 1771.
"Inversionen", also Umkehrungen der üblichen Wortstellung im Satz, sind
Kennzeichen der leidenschaftlichen Sprechweise des Sturm und Drang. Schon
der Satz, in dem Werther seinen Zorn formuliert, zeigt eine solche Inversion:
"...von allen Inversionen, die mir manchmal entfahren, ist er ein Todfeind".
~~~~~~~~~~~~
Deraisonnement = (frz.) unvernüftiges Gerede, Geschwätz
Den 8. Januar 1772.
Dass man danach trachtete, mit dem Stuhl bei Tisch - also an der
Tafel des Landesherren, Ministers, Vorgesetzten usw. - weiter
hinaufzurücken, zeigt den stark zeremoniellen Charakter von
Tischordnungen an. Die Gäste wurden entsprechend der Wichtigkeit,
die ihnen der Gastgeber zugestand, näher oder ferner von ihm plaziert.
Am 20. Januar.
Raritätenkasten = auf Jahrmärkten gezeigte Guckkästen, in denen man sich
gemalte Bilderfolgen ansehen konnte.
Den 8. Februar.
Am 17. Februar.
Am 20. Februar.
Den 15. März.
Die Szene zeigt sehr schön, wie Standesschranken
funktioniert haben - nicht über Rechte oder Verbote,
sondern über Konventionen. Obwohl der Graf Gastgeber ist und
nach Machtstellung und Rangordnung über seinen adligen Gästen steht,
kann er es sich nicht erlauben, einen Bürgerlichen in ihren
Kreis mit einzubeziehen. Das galt selbst noch für Landesherren.
Auch Friedrich Schiller, obwohl in Weimar hochangesehen, konnte
zu Empfängen des Herzogs Karl August erst eingeladen werden,
nachdem er - 1802 - geadelt worden war. Seine Nobilitierung
erfolgte geradezu zu dem Zweck, dass nicht nur seine Frau, eine
geborene von Lengefeld, sondern auch er 'bei Hofe' verkehren konnte.
~~~~~~~~~~~~
distinguiert mich = (frz.) zeichnet mich aus
en passant = (frz.)im Vorbeigehen, beiläufig
übel fourniert = (frz.) schlecht/dürftig angezogen
Kabriolett = leichte offene Kutsche
Am 16. März.
ehegestern = vorgestern
Am 24. März.
Am 19. April.
Der Dukat hatte ein Gewicht von 3,4 g Gold, das entsprach etwa
drei Konventionstalern zu je 29 g Silber (der Tauschwert von
Gold lag gegenüber der offiziellen Silberwährung nicht fest). Ein
Geschenk von 25 Dukaten (1 Dukat zu 6 Gulden = 150 Gulden) macht etwa ein Monatsgehalt
aus, wie es Goethe in den Anfangsjahren in Weimar als Minister erhielt.
Eine bürgerliche Familie hätte davon über drei Monate gut leben können.
Oder ein anderer Vergleich: zwei Zimmer im teuren Wetzlar kosteten um 1770
150 bis 180 Gulden pro Jahr.
Am 5. Mai.
Sechs Meilen = Landmeilen, d.h. rund 40 Kilometer und damit ziemlich genau
die Entfernung zwischen Darmstadt und Frankfurt, dessen Konturen sich auch
in der Beschreibung von Werthers 'Geburtsort' wiederfinden. Nur allerdings
die angedeutete Größe entspricht Frankfurt nicht, wenn der 'liebe, vertrauliche Ort'
hier einer 'unerträglichen Stadt' entgegengesetzt wird. Frankfurt war mit dazumal
36 000 Einwohnern eine der größten deutschen Städte.
Am 9. Mai.
Am 25. Mai.
Am 11. Junius.
Am 16. Junius.
Waller = Wallfahrer
Am 18. Junius.
Am 29. Julius.
Am 4. August.
Am 21. August.
Am 3. September.
Am 4. September.
Am 5. September.
Am 6. September.
Die hier beschriebene 'Werther-Kleidung' war zeittypisch und wurde
auch von Karl Wilhelm Jerusalem getragen. In "Dichtung und Wahrheit"
(12. Buch) schreibt Goethe über ihn:
Seine Kleidung war die bei den Niederdeutschen in Nachahmung der Engländer hergebrachte:
blauer Frack, ledergelbe Weste und Unterkleider und Stiefeln mit braunen Stolpen.
Das 1768 gemalte Bild des Herzogs Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha (1745-1804)
gibt die Kombination perfekt wieder, auch die beigefarbenen Lederhandschuhe
(linke Hand) darf man sich zu Werthers Ausstattung hinzudenken. - Den Herzog von
Sachsen-Gotha hat Goethe als Weimarer Minister gut kennengelernt.
Er tauschte sich in Kunstfragen mit ihm aus, begleitete ihn
auf die Jagd und wechselte mit ihm auch eine Reihe von Briefen.
 |
|
Johann Georg Ziesenis (1716-1776): Herzog Ernst Ludwig von Sachsen-Gotha (1768).
(Berlin, Staatliche Museen)
|
Am 12. September.
Am 15. September.
Für den geschilderten Eigentums-Konflikt deutet sich
folgender Hintergrund an: Da sich Pfarrer und Dorfschulze den
Erlös aus dem Verkauf der Stämme zu teilen gedachten,
muss es sich bei dem Pfarrgrundstück um Gemeindeeigentum
handeln. Doch auch der Gemeinde bzw. dem Schulzen (= Gemeindevorsteher, Bürgermeister)
wird das Eigentum an den Stämmen streitig gemacht, insofern die 'Kammer', d.h. eine
landesfürstliche Finanzbehörde, noch alte Rechte an dem Teil
des Pfarrhofs hat, wo die Bäume gestanden haben. So kann
sie die Stämme beschlagnahmen und zu ihren Gunsten versteigern
lassen. Bemerkenswert: Den Hinweis auf die 'alten Rechte' hat Goethe in der zweiten
Fassung eigens eingefügt, weil ihm die bloße Mitteilung, dass
die Kammer die Stämme beschlagnahmte, zum Verständnis offenbar
nicht ausreichte.
Bezieht man die Mitteilung, dass dies ein Ereignis in oder bei
Frankfurt war (siehe unter
GOETHE ETC.), auf den geschilderten
Rechtskonflikt, so scheidet die St.-Peters-Pfarrei der Freien Reichsstadt
Frankfurt freilich aus. Hier gab es weder einen Dorfschulzen, mit dem der
Pfarrer hätte teilen können, noch einen Landesfürsten, Pfarrhaus und Kirche
gehörten der Stadt. Man würde dann am ehesten an die Landgrafschaft Hessen denken,
wo Goethe wegen seiner Fußmärsche nach Darmstadt auch sicherlich einige Pfarrhöfe
kannte. Eine verwendbare Spur hat sich hier aber bislang nicht gefunden.
Immerhin ist die Übertragung des Falles auf die Frankfurter Verhältnisse nicht
unmöglich. Wenn der Bildhauer sich an der Erneuerung der Kirche nur gegen die
Überlassung der Stämme beteiligen wollte und der Pfarrer einwilligte, so
könnte der Magistrat sich eingemischt und die Stämme zur Versteigerung
gebracht haben, weil ihm dieses Geschäft zu ungünstig erschien. Der Wert von
Nussbaumholz war hoch. Als langsam wachsendes Holz war (und ist) es wegen seiner
schönen Maserung und Polierfähigkeit für Möbel, Gewehrschäfte
oder auch nur Tabakspfeifen hoch begehrt.
Dass Werther auf die Bestrafung der Pfarrersfrau durch die Dorfbewohner
in Form geringerer Abgaben hofft, erklärt
sich so, dass die Gemeinden ihre Pfarrer durch Naturalien zu
'besolden' hatten, dabei aber unterschiedlich großzügig sein
konnten.
Am 10. Oktober.
Am 12. Oktober.
Am 19. Oktober.
Am 26. Oktober.
Am 27. Oktober.
Am 30. Oktober.
Am 3. November.
verlechter Eimer = leckender Eimer;
eherner Himmel = bronzefarbener Himmel
Am 8. November.
Am 15. November.
Am 21. November.
Am 22. November.
wenn ich mir's nachließe, es gäbe eine ganze Litanei von Antithesen = wenn
ich es mir gestattete, könnte ich das Widersprüchliche meines Verhaltens breit ausführen
Am 24. November.
Am 26. November.
Am 30. November.
Generalstaaten = bis 1795 der Name der Niederlande, hier offenbar ein Bezugspunkt
für die Einbildungen des Schreibers, weil die Niederlande eine reiche Handelsnation waren.
Jelängerjelieber = Geißblatt, üppig blühende Rankpflanze
Tausendgüldenkraut = blassrot blühendes Doldengewächs,
dem allerlei Heilwirkungen nachgesagt werden.
Am 1. Dezember.
Am 4. Dezember.
Das häusliche Klavierspiel im 18. Jahrhundert fand noch nicht
auf dem uns bekannten Hammerklavier (auch Pianoforte genannt) statt,
sondern auf dem kleineren Klavichord. Die Saiten wurden bei diesem
Instrument durch Eisenstifte zum Klingen gebracht, weshalb Ton und
Lautstärke durch den Anschlag noch kaum moduliert werden konnten
(Ein Klangbeispiel siehe unter
ZITATE).
Wie solche Instrumente aussahen, siehe unter den
ILLUSTRATIONEN zu diesem Brief.
Am 6. Dezember.
{BERICHTSTEIL I}
in seinem wirksamen Leben = als er noch berufstätig war
schien ihr Schweigen empfunden zu haben = schien ihr Schweigen als
einen Vorwurf gegen sich empfunden zu haben
{BRIEFEINLAGE I)
{BRIEFEINLAGE II}
{BRIEFEINLAGE III}
{BERICHTSTEIL II}
politisch = hier: berechnend, gefühllos
Kontos fordern = Abrechnungen machen lassen
{OSSIAN}
{ABSCHIED}
Werthers Knabe = Diener
ängstliche Lade = Sarg
{ENDE}
"Blick vom Pulver" = der Lichtblitz, der bei einer Steinschloss-Pistole
durch die Zündung des Pulvers auf der Pfanne entsteht (Näheres
siehe unter
KULTURELLES zum
Brief vom 12. August 1771).
~~~~~~~~~~~~
Die Beerdigung bei Nacht und das Tragen des Sarges durch
Handwerker waren im 18. Jahrhundert üblich, doch dass kein
Geistlicher den Totenzug begleitet, ist Werthers Selbsttötung
zuzuschreiben. Sich das von Gott gegebene Leben selbst zu nehmen ist
nach christlicher Auffassung nicht erlaubt, und da überdies der Selbstmörder
seine Tat nicht bereuen, also auch keine Absolution erhalten kann, konnte
Selbstmördern die Bestattung auf den im 18. Jahrhundert allein
vorhandenen kirchlichen Friedhöfen verweigert werden. Die Bestattung
erfolgte in solchen Fällen entweder außen an der Kirchhofsmauer
oder sogar auf dem Schindanger, dem Ablageplatz für Tierkadaver
und Hingerichtete. Werther erhält dank der Fürsorge des Amtmanns
immerhin ein Grab auf dem Friedhof - und sogar an der von ihm gewünschten Stelle.