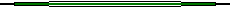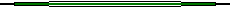Erstes Kapitel

»... auch drückt es ihn nicht, etwas von mir anzunehmen, denn wir sind unsre Lebzeit über einander wechselseitig uns so viel schuldig
geworden, dass wir nicht berechnen können, wie unser Kredit und Debet sich gegeneinander verhalte ...«
Kredit und Debet: Guthaben und Schuld. Bei den heutigen Geldkarten haben die Begriffe ihre Bedeutung fast umgekehrt. Die Kreditkarte ist eine Karte, hinter der zunächst kein Guthaben steckt, sondern das Geld als noch zu begleichende Schuld auf dem Zahler lastet. Die Debitkarte (umgangssprachlich 'Scheckkarte') ist eine Karte, bei der mit einem üblicherweise vorhandenen Guthaben unmittelbar bezahlt wird.
Zweites Kapitel

Solange er im Dienste war, hatte sich kein Ehepaar scheiden lassen, und die Landeskollegien wurden mit keinen Händeln und Prozessen von dorther behelliget.
Landeskollegien: im Unterschied zu den Einzelrichtern (Amtsrichtern) die übergeordneten Gerichtsstände, bei denen ein Richterkollegium die Entscheidungen traf.
Drittes Kapitel

Der Hauptmann gefiel sich sehr in der Gegend und bemerkte jede Schönheit ...
gefiel sich sehr: hier in der älteren Bedeutung von "sich wohlfühlen", wie sie auch in einer Wendung wie "Er gefiel sich in spöttischen Bemerkungen" noch vorkommt.

... machte er doch nicht, wie es öfters zu geschehen pflegt, ... dadurch einen üblen Humor, dass er mehr verlangte, als die Umstände zuließen ...
Humor: eigentlich lat. "Feuchtigkeit", dann nach der mittelalterlichen Naturlehre für "Temperament" gebraucht. Deshalb hier noch in der neutralen Bedeutung von "Laune" oder "Stimmung".
~~~~~~~~~~~~

Als sie die Mooshütte erreichten, fanden sie solche auf das Lustigste ausgeschmückt
auf das Lustigste: hier allgemein als "Lust machend" zu verstehen, also im Sinne von "erfreulich".
Viertes Kapitel
Die topographische Karte, auf welcher das Gut mit seinen Umgebungen nach einem ziemlich großen Maßstabe charakteristisch und
fasslich durch Federstriche und Farben dargestellt war und welche der Hauptmann durch einige trigonometrische Messungen sicher zu gründen wusste ...
trigonometrische Messungen: Messungen in Dreiecksform, bei denen sich aus den Seitenlängen stets auch die Winkel bestimmen lassen. Die Dreipunkt-Messung ist bis heute das Grundprinzip jeder Landvermessung.
~~~~~~~~~~~~
Sie errichteten auf dem Flügel des Hauptmanns eine Repositur für das Gegenwärtige, ein Archiv für das Vergangene ...
Repositur: systematische Aktenablage, oft in einem Repositorium, einem Schrank mit vielen flachen Fächern.
~~~~~~~~~~~~
»So verbinden wir«, fiel der Hauptmann ein, »das Öl
durch Laugensalz mit dem Wasser«.
Laugensalz: Natriumkarbonat, umgangssprachlich 'Soda'.
~~~~~~~~~~~~
»... An den Alkalien und Säuren, die sich am entschiedensten suchen und fassen, ist diese Verwandtschaft auffallend genug. ...«
Alkalien: Kalium- und Natriumoxyd bzw. -hydroxyd. Beim Übergießen mit Säuren sprudelt Kohlendioxyd mehr oder minder heftig aus.
~~~~~~~~~~~~
»... Am Ende bin ich in deinen Augen der Kalk, der vom Hauptmann, als einer Schwefelsäure, ergriffen, deiner anmutigen Gesellschaft entzogen und in einen
refraktären Gips verwandelt wird.«
refraktär: träge reagierend, d.h. nur schwer noch mit einem anderen Stoff, z.B. Wasser, zu verbinden.
Fünftes Kapitel

Im Französischen überparlierten und überexponierten sie manche ...
überparlierten und überexponierten: sprachen andere flüssiger und mit reicherem Wortschatz
Sechstes Kapitel

... ein Lustgebäude aufführen; dieses sollte einen Bezug
aufs Schloss haben; aus den Schlossfenstern sollte man es übersehen, von dorther Schloss und Gärten wieder bestreichen können.
übersehen und bestreichen: wahrnehmen und ins Auge fassen. Die militärische Ausdrucksweise soll wohl kennzeichnen, wie der Hauptmann als ehemaliger Offizier die Geländeverhältnisse beurteilt.
Siebentes Kapitel

Sie bestellten sich deshalb auf ihre Kanzlei, wo sie den alten Kopisten müßig fanden.
Kopist: Schreiber
Achtes Kapitel

Der Hauptmann untersuchte gleich am frühsten Morgen den Platz, entwarf ... einen genauen Riss nebst Anschlag und allem Erforderlichen.
Riss nebst Anschlag: Bauzeichnung und Materialbedarf mit Kostenschätzung
~~~~~~~~~~~~

»Und Sie können, Sie wollen mich auf dem Flügel begleiten?«, rief Eduard, dem die
Augen vor Freude glänzten. ... Sie brachte die Noten herbei und setzte sich ans Klavier.
Flügel / Klavier: Zur Goethezeit fasste man alle Tasteninstrumente noch unter dem Begriff "Kavier" zusammen, der Flügel war nur die besondere Bauform.
Neuntes Kapitel

Diesen Grundstein, der ... mit seiner wasser- und senkrechten Lage Lot und Waage aller Mauern und Wände bezeichnet ...
wasser- und senkrechte Lage: das Einmessen des Steins mit Wasserwaage und Lot
~~~~~~~~~~~~

»... bis wir den Vorwerksverkauf in Ordnung gebracht. Der Aufsatz ist fertig, die eine Abschrift habe ich
hier ...«
Aufsatz: Schriftsatz, Vertrag
Zehntes Kapitel

... indem sie sich mancherlei vertrauten und zugleich die neuesten Formen und Zuschnitte von Frühkleidern,
Hüten und dergleichen zu mustern anfingen ...
Frühkleider: Morgenröcke, bequeme Hauskleidung im Unterschied zu den Kleidern, die in Gesellschaft getragen wurden.
~~~~~~~~~~~~

... und die Schwierigkeiten, sich von seiner Gemahlin getrennt zu sehen ...
getrennt zu sehen: trennen zu können
~~~~~~~~~~~~

... »Ich muss mich seiner annehmen«, fiel die Baronesse ein.
mich seiner annehmen: ihn in Schutz nehmen, ihn verteidigen
~~~~~~~~~~~~

»... und es liegt doch eigentlich nur an der plumpen Sicherheit, auf die sich wenigstens ein Teil etwas zugute tut.«
plumpe Sicherheit: ein Eheteil wenigstens hat immer materielle Interessen bei einer Heirat, auf Liebe und Zuneigung kommt es in der Regel nicht an.
Elftes Kapitel

Sie warf sich auf das Sofa und überließ sich ganz ihrem Schmerz.
Bei Goethe heißt es noch "den Sofa".
~~~~~~~~~~~~

... Frauen, die, von Natur mäßig, im Ehestande ohne Vorsatz und Anstrengung
die Art und Weise der Liebhaberinnen fortführen.
Liebhaberinnen: nach dem heutigen Wortverständnis müsste es "Geliebten" heißen, da "Liebhaberin" eher eine aktive, werbende Rolle andeutet.
Zwölftes Kapitel

»Dass dieser Augenblick in unserm Leben Epoche mache, können wir nicht
verhindern...«
Epoche machen: diesen etwas hölzernen Ausdruck für einen bedeutsamen Lebensmoment oder Lebensabschnitt verwendet Goethe einige Male, besonders gleichartig im
VIERTEN KAPITEL.
~~~~~~~~~~~~

Bald ergreift sie eine süße Müdigkeit und ruhig schläft sie ein.
Den Wechsel ins Präsens, der sich im folgenden Kapitel fortsetzt, hat man als Signal für ein jeweils dämonisch bestimmtes Geschehen gedeutet, unterschieden von
selbstverantwortlich gesteuerten Vorgängen. Beispielhaft belegt wird das an dem im Präsens
geschilderten Unfall mit dem Kind (siehe
ZWEITER TEIL, DREIZEHNTES KAPITEL).
Durchhalten lässt sich diese Bewertung jedoch nicht. Warum wäre Eduards Wachzustand, gleich anschließend im Präsens mitgeteilt, ihm dämonisch verordnet,
während sein Einschlafen im Unterschied zu dem Charlottes als selbstgesteuert gelten müsste?

Er hing ganz seinen glücklichen Träumen nach, schlief endlich ein und erwachte nicht eher wieder, als bis die Sonne mit herrlichem Blick heraufstieg ...
Goethe war einfach kein so über jeden Zweifel erhabener Erzähler, dass man hinter jeder sprachlichen Inkonsequenz einen gestalterischen Gesamtplan vermuten
muss. Sein am besten erzählter Roman sind die Leiden des jungen Werthers, ein weitgehend in der Ich-Form gehaltenes leidenschaftliches Bekenntnisbuch, das
bis auf den Schluss gerade keinen neutralen Beobachter und Berichterstatter kennt.
Vierzehntes Kapitel

indem sie als ungebildete Selbstler das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirken sollen.
Selbstler: Egoisten
Sechzehntes Kapitel

... und so, wie schon im Stegreife, setzte er sich hin und schrieb.
im Stegreife: im Steg-Reife, also im Steigbügel
Siebzehntes Kapitel

Es kam ihr wunderbar vor, dass er das Haus verließ, ohne sie gesehen, ohne ihr einen Morgengruß geboten zu haben.
wunderbar: wunderlich, sonderbar
~~~~~~~~~~~~

Man ließ den Knaben eine Art von heiterer Montierung machen ...
Montierung: Montur, Uniform

Man fand an ihnen eine bequeme Dressur ...
Dressur: Lernbereitschaft, Anstelligkeit
~~~~~~~~~~~~

Aber aus einer Anzahl Mädchen lässt sich kein Chor bilden wie aus einer Anzahl Knaben.
Chor: Korps, Körperschaft, gemeinschaftliche Einheit
Achtzehntes Kapitel

»... Ich verwünsche die Glücklichen, denen der Unglückliche nur zum Spektakel dienen soll ...«
Spektakel: Schauspiel, ein nur beobachteter, nicht teilnehmend aufgenommener Vorgang
| Sprachliches /Zweiter Teil |
Erstes Kapitel

Im gemeinen Leben begegnet uns oft, was wir in der Epopöe als Kunstgriff des Dichters zu rühmen pflegen ...
Epopöe: wie ein Epos gemacht, also in einem eposgleichen Dichtwerk. Goethe will den Begriff Roman offenbar nicht benutzen, um das Kunstmittel
nicht dem Verdacht auszusetzen, dass es trivial ist. Der Begriff Epopöe sollte erkennen lassen, dass man 'Epos' nur die Epen der Antike nennen wollte,
besonders die Werke von Vergil und Homer.
Zweites Kapitel

Man konnte wohl nachkommen ...
nachkommen: erkennen, darauf kommen - ein nur für Goethe überlieferter Wortgebrauch.
~~~~~~~~~~~~

... und mit dem davor liegenden Auferstehungsfelde zur Übereinstimmung zu bringen gedachte.
Auferstehungsfeld: Gräberfeld
~~~~~~~~~~~~

tat ein größeres Portefeuille, das er zuletzt herbeibrachte, die beste Wirkung.
Portefeuille: Mappe
Drittes Kapitel

Wenn gewöhnliche Menschen, durch gemeine Verlegenheiten des Tags zu einem leidenschaftlich ängstlichen Betragen aufgeregt ...
gemeine Verlegenheiten: allgemeine, übliche Verlegenheiten
Viertes Kapitel

... denn er machte in seiner ganz schwarzen, knappen, modernen Zivilgestalt einen wunderlichen Kontrast mit
jenen Flören, Kreppen, Fransen, Schmelzen, Quasten und Kronen ...
Flören: als Plural von 'Flor' verschiedene dünne Gewebe (heute noch üblich im 'Trauerflor').
Kreppen: als Plural von 'Krepp' verschiedene dickere Gewebe
Schmelzen: farbige kleine Glasstücke in Stickereien
Sechstes Kapitel
... wenn nicht die Sozietät selbst aus Neugierde und Apprehension sich ungeschickt benommen ...
Apprehension: Befangenheit, Besorgnis
~~~~~~~~~~~~
»Gewiss«, versetzte der Architekt, »würden alsdann Kustoden und Liebhaber ihre Seltenheiten
fröhlicher mitteilen«.
Kustoden: Museumswärter, Verwalter von Kunstsammlungen
~~~~~~~~~~~~
... und Ottiliens Gegenwart schien ihm statt alles Labsals zu sein ...
statt alles Labsals: "Ersatz alles Labsals".
Siebentes Kapitel
... denn was er sich nach seiner Entfernung musste gefallen lassen, das wollte er wenigstens gegenwärtig nicht erleben.
nach seiner Entfernung: richtiger wäre "für seine Entfernung", denn danach kann er sich eigentlich nichts mehr gefallen lassen, da er es nicht mehr erlebt.
~~~~~~~~~~~~
»Recht gern«, versetzte jener; »nur müssen Sie mich nicht verraten ...«
nicht verraten: wenn Sie es für sich behalten, nicht weitersagen.
~~~~~~~~~~~~
... mit jedem Grashalm, über den wir hinwandeln, haben wir ein wahres
Verhältnis; sie sind unsre echten Kompatrioten.
Kompatrioten: Landsleute
~~~~~~~~~~~~
Es wandelt niemand ungestraft unter Palmen ...
Dieser berühmt gewordene Satz wird oft missverstehend zitiert. 'Ungestraft' meint hier nur 'unbeeinflusst', es muss keine schädliche Wirkung von der Fremde ausgehen. Etwas anderes ergibt sich, wenn man die Sentenz mit Lessings Schauspiel Nathan der Weise (1779) in Verbindung bringt, aus dem Goethe sie - sicherlich unbewusst - abgeleitet hat. Dort geht immer wieder der Tempelherr unter Palmen auf und ab, der Recha aus einem Feuer gerettet hat. Rechas Dienerin Daja versucht ihm dafür zu danken, wird aber von ihm zurückgewiesen. Da sie nicht von ihm ablässt, sagt er schließlich zu ihr: "Weib, macht mir die Palmen nicht / Verhasst, worunter ich so gern sonst wandle." (1. Akt, 6. Szene) Er möchte also gern 'ungestraft unter Palmen wandeln', doch es ist ihm nicht vergönnt.
Neuntes Kapitel

Was die Herrschaft voriges Jahr zu verschreiben angefangen, hielt er um so mehr für unnützen Aufwand ...
zu verschreiben angefangen: zu besorgen aufgetragen, so wie auch heute noch der Arzt ein Medikament 'verschreibt'.

... als er gar manche kostbare Pflanze ausgehen sah ...
ausgehen sah: eingehen sah.
~~~~~~~~~~~~

Ein Leben ohne Liebe, ohne die Nähe des Geliebten ist nur eine Comédie à tiroir, ein schlechtes Schubladenstück.
Comédie à tiroir: wörtlich 'Komödie nach Schubladenart', also mit beliebig austauschbaren Szenen.
Zehntes Kapitel

Ein Tischer, ein Tapezier, ein Maler, der mit Patronen und leichter Vergoldung sich zu helfen wusste, nur dieser bedurfte man ...
Tischer: Tischler
Tapezier: Tapezierer, ein noch besonderes Handwerk, weil alle Stoffbespannungen von diesem ausgeführt wurden.
Maler mit Patronen: mit Schablonen, die zur Gestaltung von Wand- und Deckenfriesen verwendet wurden.
~~~~~~~~~~~~

»... und gerade, was wir am meisten bedürften, ist vergessen.«
ist vergessen: wurde (zu Hause) vergessen.
Elftes Kapitel

Er hatte seinen Apparat von goldnen Ringen, Markasiten und andern metallischen Substanzen ...
Markasiten: eisenhaltige Mineralien (Eisendisulfite), auch als Pyrit, Schwefelkies, Katzengold und anders bezeichnet.
~~~~~~~~~~~~

... lehnte den wohlgesinnten Antrag ab, weil sie nicht gemeint war, in ihrer Umgebung etwas zuzulassen, wovor sie immerfort eine starke Apprehension gefühlt hatte.
gemeint war: nicht gestimmt war, nicht geneigt war
Apprehension: Befangenheit, Besorgnis
~~~~~~~~~~~~

... und so bildete sie, das Kind auf dem Arm, lesend und wandelnd, eine gar anmutige Penserosa.
Penserosa: eigentl. 'Pensierosa', eine Gedankenverlorene. So ganz trifft der Begriff auf sie aber nicht zu. Der Pensieroso als 'Mann in Gedanken' liest nicht, sondern
er ist in sich gekehrt. Mit dem Fremdwort wird Ottilies Abgelenktheit also ironisch überhöht und damit abgewertet. Ihr beiläufiges Lesen ist mehr eine
fragwürdige Mode als ehrenwerte Nachdenklichkeit.
Dass dies auch von den ersten Lesern so aufgenommen worden ist oder werden konnte, belegt ein Tagebucheintrag von Rahel Varnhagen von Ense. Sie notiert im Mai 1823: "Daß sie (Ottilie) mit dem Kind auf dem Arm im Spazierengehn noch nebenher liest, empört mich bis zur Grausamkeit. Gerechter Gott, wie kann einem das einfallen, wenn man ein holdes Kind zu besorgen hat und im Freien ist!"
Zwölftes Kapitel

... von der Ehre zweier Männer, die, bis jetzt unbescholten, durch diese wunderliche Handlung, wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen, in Gefahr kommen ...
wenn wir sie auch nicht anders nennen wollen: um keinen schlimmeren Ausdruck zu gebrauchen.
Vierzehntes Kapitel

...den Zweck seiner Sendung, insofern Eduard ihn abgeschickt hatte, den Zweck seines Kommens, insofern sein freier Wille, sein eigenes Interesse dabei war.
Die knappe Zusammenfassung kann übersehen lassen, was hier vorgetragen wird. Der Major macht Charlotte nicht nur mit Eduards Wunsch bekannt, sich von ihr scheiden zu lassen, sondern er greift auch dessen Angebot auf, sie zu heiraten. Mit anderen Worten: er macht ihr, während das tote Kind neben ihr liegt, einen Heiratsantrag. Deshalb auch seine Nachfrage, nachdem sie ihre Einwilligung in die Scheidung umfänglich begründet hat, was er für sich selbst '
hoffen dürfe'.
Fünfzehntes Kapitel

Nach so viel wundervollen und unglücklichen Ereignissen ...
wundervoll: unerwartet, - und trotzdem hier ein befremdlicher Ausdruck, da man sich über den Tod eines Kindes ja nicht wundert. Außerdem hat es nur ein einziges
unglückliches Ereignis gegeben. Ihm eine Mehrzahl von Begleitvorgängen an die Seite zu stellen, zeigt nur wieder, wie wenig schwer auch für den Erzähler
dieser Todesfall wiegt.
~~~~~~~~~~~~

»Wie heiter werde ich die Verlegenheiten der jungen Ausschößlinge betrachten ...«
Ausschößlinge: die jüngsten der Pensionskinder, die sich gerade vom Schoß der Mutter gelöst haben.