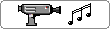{VORREDE}
Am 4. Mai 1771.
Am 10. Mai.
Hinweise und Anspielungen auf literarische Werke gibt es im 'Werther' in
zweifacher Form: solche, die offen von Werther selbst stammen, und solche,
die Goethe gleichsam hinter seinem Rücken gebraucht. Klar gegeneinander
abgrenzen lassen sie sich allerdings nicht, da auch die verdeckten
literarischen Reminiszenzen teilweise Werther zugerechnet werden könnten -
je nachdem, wieviel literarisches Bewußtsein man ihm in der Abfassung
seiner Briefe zutraut. Daß Goethe an eine solche Ausdifferenzierung
gedacht hat, ist allerdings auszuschließen.
~~~~~~~~~~~~
Die Aussage Werthers, "Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen
Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken",
dürfte man als literarische Reminiszenz aber nur Goethe zurechnen.
Sie erinnert an Lessings Trauerspiel "Emilia Galotti", welches jedoch
erst im Frühjahr 1772 erschien, mithin Werther 1771 noch nicht bekannt
gewesen sein könnte. Dort sagt Conti im Gespräch mit Gonzaga in I/4,
"daß ich wirklich ein großer Maler bin, daß es aber meine Hand nur nicht
immer ist", und er gibt zu bedenken, ob nicht jemand wie Raffael selbst
dann "das größte malerische Genie gewesen wäre, wenn er unglücklicherweise
ohne Hände wäre geboren worden". - Die Idee, die hinter dieser -
eigentlich unsinnigen - Annahme steckt, ist kennzeichnend für den
Genie-Begriff des Sturm und Drang, kommt vollends aber erst in in der
Romantik zum Durchbruch: das Gefühl für das Schöne, das Kunstwerk in
der Phantasie zählen mehr als alles Ausdrücken- und Abbilden-Können.
Ob für Werther damit eine Neigung zur Selbstüberschätzung angedeutet werden soll,
ist schwer zu entscheiden.
Am 12. Mai.
Melusine - französische Sagengestalt, die halb Weib, halb Fisch ist und
nach der enttäuschten Liebe zu einem Mann wieder in die Wasserwelt zurückkehrt.
Dieselbe Gestalt kommt in der Literatur auch als Undine oder - im Märchen
von Hans Christian Andersen - als "kleine Meerjungfrau" vor.
~~~~~~~~~~~~
Daß die "Altväter" am Brunnen Bekanntschaft machen und freien,
bezieht sich auf die Bibel. Im Alten Testament wird im 1. Buch
Moses, Kap. 24, in den Versen 11-20 die Brautwerbung für Abrahams
Sohn Isaak erzählt. Der Knecht Abrahams soll vor der Stadt am
Brunnen warten, zu dem abends "die Töchter der Leute dieser
Stadt werden herauskommen, um Wasser zu schöpfen", und soll
eine finden, die ihm barmherzig aus ihrem Krug zu trinken gibt.
Er findet Rebekka und sie wird Isaaks Frau.
Am 13. Mai.
Wenn Werther sich nicht mehr auf Bücher einlassen will, durch
die er "geleitet, ermuntert, angefeuert" wird, sondern nur noch
auf den "Wiegengesang" der Verse Homers, so ist das auch eine
Absage an die Zweckbestimmung des Lesens im Sinne der Aufklärung.
Daß ausgerechnet die Leidensgeschichte des Odysseus (Werther nennt
im weiteren nur die Odyssee) eine solche beschwichtigende Wirkung
auf ihn hat, ist allerdings nicht ohne weiteres nachzuvollziehen.
Es scheint, als fasse er mehr nur einzelne Szenen als den Sinn
des ganzen ins Auge, und auch der fremde Klang und Rhythmus
dürften zur Vernachlässigung der Zusammenhänge beitragen. Ein
wichtiges Moment ist aber auch der fatalistische Gleichmut,
mit dem das Schicksal des 'herrlichen Dulders' erzählt wird. Im
Unterschied zu den später für Werther in den Vordergrund tretenden
Gesängen Ossians, die ganz auf Klage und Trauer gestimmt sind,
werden in der Odyssee alle Unglücksfälle als unabwendbare schlicht
hingenommen , erschüttern aber nicht die Gewißheit, daß die Welt
in Ordnung ist und das Ende gut sein wird .
Am 15. Mai.
Den 17. Mai.
Charles Batteux, Robert Wood, Roger de Piles, Johann Joachim
Winckelmann, Johann Georg Sulzer und Christian Gottlieb Heyne:
namhafte französische, englische und deutsche Kunsttheoretiker
des 18. Jahrhunderts. Mit dem Besitz von Manuskripten - d.h.
Vorlesungsmitschriften - von Gelehrten wie hier des Göttinger
Altphilologen Heyne (1729-1812) wies man sich als besonderer
Kenner eines Wissensgebietes aus.
Am 22. Mai.
Am 26. Mai.
Am 27. Mai.
Am 30. Mai.
Am 16. Junius.
Daß bestimmte Titel nicht genannt sind für die Bücher, die Lotte
nicht gefallen und die ihr gefallen haben, ist sicherlich echte
Rücksicht auf die Empfindlichkeit von Autoren und Verlegern.
Daß Goethe stattdessen aber auch keine Namen erfindet, hat mit
dem Wahrheitsanspruch zu tun - es wäre eine Erfindung in dieser
Hinsicht allzu leicht durchschaubar gewesen.
~~~~~~~~~~~~
Miß Jenny = vielleicht eine Anspielung auf Marie-Jeanne Riccobonis
"Geschichte der Miss Jenny Glanville" (1764) oder allgemein auf
einen Roman dieser empfindsamen Richtung, in der immer schöne junge Frauen von
Schurken getäuscht, entführt oder an sie verkuppelt werden, ehe der
wahre Geliebte alle Widerstände überwinden und sie heimführen kann.
~~~~~~~~~~~~
Landpriester von Wakefield = Den Roman "The Vicar of Wakefield" (1766)
von Oliver Goldsmith hatte Goethe 1771 in Straßburg durch Herder
kennengelernt und erklärt ihn noch in "Dichtung und Wahrheit" (10.Buch)
zu "einem der besten, die je geschrieben wurden". Ihn entzückte vor
allem die Lebenseinstellung des Landpredigers Primrose, der gegenüber
allen ihn treffenden Schicksalsschlägen wie Vermögensverlusten, entführten
Töchtern, einen des Mordes verdächtigten Sohn usw. einen ironisch-heiteren
Abstand wahrt und am Ende durch glückliche Fügungen auch aus allem
Unheil wieder herauskommt.
~~~~~~~~~~~~
Als Beispiel für ein Menuett ein Satz aus der Ouvertüre C-Dur von
Johann Sebastian Bach (entstanden um 1725)
~~~~~~~~~~~~
Als Beispiel für einen 'Englischen' ein Contretanz von Joseph Haydn (1732-1809)
~~~~~~~~~~~~
Als Beispiel für einen 'Deutschen' ein deutscher Tanz von
Mozart (1759-1791): "Die Leyerer". Im mittleren Teil wird
die Leyer imitiert, die bei privaten Tanzbelustigungen oft das einzige
Instrument war und dem Klangbild der Musik bei einem 'Volksball' ziemlich
nahe kommen dürfte.
~~~~~~~~~~~~
Da sich in Kestners Aufzeichnungen zum 9. Juni 1772 (siehe unter
GOETHE ETC.)
keinerlei Hinweis darauf findet, daß es während des Balles
in Volpertshausen ein Gewitter gegeben hat, und da Kestner zu dem Spiel mit
den Ohrfeigen auch schreibt, die wirkliche Lotte "wäre nie imstande gewesen,
sich so zu benehmen" (nicht jedoch: sie habe sich so nicht benommen), muß man das
Gewitter für Goethes Zutat halten. Ein Grund für diese Zutat
könnte die daran sich anschließende Klopstock-Reminiszenz sein,
doch hätten andere Briefe dafür bequemere Möglichkeiten geboten.
Wie Jürgen-Paul Schwindt in einer sorgfältigen Analyse erschlossen hat,
darf man deshalb in dem Gewitter und zumal in der Szene, als Werther
und Lotte nach dem Gewitter abgesondert von den anderen an ein Fenster
treten, eine andere literarische Anspielung vermuten. Es ist Vergils
Äneis mit dem Rückzug von Dido und Äneas vor einem Gewitter in eine
Höhle (Buch IV, Verse 117 ff.). Diese oft zitierte Szene ist zugleich
der Moment der Begründung ihres Liebesbundes, an dessen Ende, weil
Aeneas sie verläßt, der Selbstmord von Dido steht. So läßt sich
diese Szene, die Rollen der Liebenden vertauscht, als ein Hinweis
auf das Ende Werthers verstehen - oder umgekehrt als eine Erinnerung
daran, daß Liebesverhältnisse mit einem solchen fatalen Ausgang schon
aus den ältesten Zeiten bekannt sind.
~~~~~~~~~~~~
Mit dem Namen "Klopstock" beim Blick auf das Gewitter erinnert Lotte
an die letzten Strophen seiner Ode "Die Frühlingsfeier" (1759). Den
Hinweis auf die 'herrliche Ode' hat Goethe in der zweiten Fassung
eigens eingefügt, weil er den Namen Klopstocks allein wohl nicht
mehr für deutlich genug hielt. Die 'Frühlingsfeier' im ganzen ist
ein Lob Gottes im Angesicht der Natur, unter Einschluß eben eines
Gewitters, das Gottes Allmacht drohend, aber zum Schluß auch segnend
zeigt:
|
Seht ihr den neuen Zeugen des Nahen, den fliegenden Strahl? Höret ihr hoch in der Wolke den Donner des Herrn? Er ruft: Jehovah, Jehovah! Und der geschmetterte Wald dampft, Aber nicht unsre Hütte! Unser Vater gebot Seinem Verderber, Vor unsrer Hütte vorüberzugehn! Ach, schon rauscht, schon rauscht Himmel und Erde vom gnädigen Regen! Nun ist - wie dürstete sie! - die Erd' erquickt Und der Himmel der Segensfüll' entlastet Siehe, nun kommt Jehovah nicht mehr im Wetter, In stillem, sanftem Säuseln Kommt Jehovah, Und unter ihm neigt sich der Bogen des Friedens! |
Am 19. Junius.
Am 21. Junius.
Daß Werther sich mit den Freiern gleichsetzt, die im Haus des
Odysseus um dessen Gattin Penelope werben und sich dessen Ochsen
und Schweine schmecken lassen, ist etwas sonderbar (vgl. Homer,
"Odyssee", XX. Gesang, Vers 213 bis 280). Ihr Tun ist Unrecht,
und sie werden alle dafür umgebracht. Werther erinnert sich aber
offenbar nur an das Behagen, das im Verhalten der Freier zum Ausdruck
kommt.
Am 29. Junius.
Im Neuen Testament, Evangelium des Matthäus, Kap. 18, 1-5, fragen
die Jünger, wer der Größte im Himmelreich sei, und Jesus stellt
ein Kind unter sie und sagt, man müsse werden wie dieses, um ins
Himmelreich zu kommen.
Am 1. Julius.
"... und sing ein paar Contretänze den Garten auf und ab ..." = Zum Contretanz
siehe unter
KULTURELLES zum 16. Juni 1771.
Bestimmte dieser Tanzmelodien waren weit verbreitet.
~~~~~~~~~~~~
Die Predigt von Johann Caspar Lavater ((1741-1801) über "Mittel
gegen Unzufriedenheit und üble Laune" im zweiten Teil der
"Predigten über das Buch Jonas" erschien 1773 in Zürich. Mit
seiner Formulierung, daß es "nun" diese Predigt gibt, macht
Goethe bzw. macht der Herausgeber deutlich, daß sich Werther
bereits vor der Veröffentlichung jener Predigt Gedanken dieser
Art gemacht hat.
Am 6. Julius.
Am 8. Julius.
Am 10. Julius.
Erste beiläufige Erwähnung der Gesänge des gälischen Barden
Ossian aus dem 3. Jahrhundert, die in Wahrheit Dichtungen
des Schotten James Macpherson (1736-1796) waren. Ab 1762 von
ihm in 'englischer Übersetzung' veröffentlicht, lagen sie
bereits 1764 auch in einer deutschen Fassung vor.
Am 11. Julius.
Das Alte Testament, 1. Buch Könige, Kap. 17, Vers 10-16, erzählt die
Geschichte des Propheten Elia, der von einer Witwe ernährt wird, indem
Gott das Mehl in ihrem Topf und das Öl in ihrem Krug nicht alle werden
läßt.
Am 13. Julius.
Am 16. Julius.
An welche Melodie für Lottes 'Leiblied' Goethe gedacht hat und
ob ihm überhaupt ein bestimmtes Lied vorschwebte, wissen wir nicht.
Als Beispiel für Klang und Typus solcher Klavier- (eigentlich: Klavichord-)
Stücke hier ein Satz aus einer Sonate von Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792)
aus dem Jahre 1775. Wie aus einem Brief vom 23. November 1773 an Johanna Fahlmer hervorgeht,
hat Goethe die 'beliebten Kompositionen' von Wolf auch gekannt.
Am 18. Julius.
Den 19. Julius.
Den 20. Julius.
Am 24. Julius.
Am 26. Julius.
Das "Magnetenberg"-Motiv kommt in allen Kulturen vor und
hat mit der Wahrnehmung des Erdmagnetismus zu tun, der schon
in der Spätantike zum Gebrauch von Kompass-Nadeln führte.
Im Mittelalter wurden besonders in Nordeuropa daran
abenteuerliche Erzählungen geknüpft, die ihren Niederschlag
u.a. im Gudrun-Lied (11. Jh.) und im "Herzog Ernst"-Epos
(um 1180) gefunden haben. Goethes Quelle ist wahrscheinlich
die arabische Geschichten-Sammlung von "Tausendundeiner Nacht",
wo das Motiv in der Erzählung des 'dritten Bettelmönchs' (14. Nacht)
eine Rolle spielt. "Tausendundeine Nacht" war in Deutschland seit 1730
durch Übertragungen der französischen Ausgabe von Antoine Galland bekannt.
Am 30. Julius.
Am 8. August.
Am 10. August.
Am 12. August.
Werthers Verurteilung der "sittlichen Menschen", die an den
Trunkenen vorbeigehen "wie der Priester" und Gott danken
"wie der Pharisäer", daß er sie nicht ebenso gemacht hat,
bezieht sich auf das Neue Testament, Evangelium des Lukas,
Kap. 10, Vers 31, und Kap. 18, Vers 11. Der vorbeigehende
Priester läßt den Beraubten im Gleichnis vom Barmherzigen
Samariter hilflos liegen, und der Pharisäer dankt Gott im
Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner, daß er kein Räuber,
Betrüger oder Zöllner ist. Der Zöllner jedoch bittet Gott
nur um Gnade. Die Auskunft von Jesus dazu: Wer sich selbst
erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst
erniedrigt, der wird erhöht werden.
~~~~~~~~~~~~
Die "Krankheit zum Tode", wie Werther die Selbstmord-Neigung
nennt, könnte ein Anklang an das Neue Testament, Evangelium
des Johannes, Kap. 11, Vers.4, sein. Dort allerdings heißt es,
die Krankheit (des Lazarus) führe nicht zum Tod, sondern diene
der Ehre Gottes. Denn als Lazarus stirbt, weckt Jesus ihn wieder
auf und gewinnt so weitere Anhänger. - Daß Sören Kierkegaard
seine 1849 erschienene Schrift über die Verzweiflung "Die
Krankheit zum Tode" betitelt (Sygdommen til döden), könnte
eine Entlehnung aus dem 'Werther' sein.
Am 15. August.
Das Märchen der gefangenen Prinzessin, die von Händen bedient wird,
die aus der Zimmerdecke wachsen, ist ein Feenmärchen aus der 1698 erschienenen
Sammlung "Les illustres fées" von Marie de Berneville,
Gräfin von Aulnoy.
Am 18. August.
Am 21. August.
Am 22. August.
Die "Fabel vom Pferde", das zuschanden geritten wird,
meint die schon von Äsop erzählte Fabel von dem Pferd,
das sich, auf seiner Weide von einem Hirsch bedrängt,
hilfesuchend an den Menschen wendet und von ihm dann im
Kampf gegen den Hirsch als Reittier eingesetzt wird.
Als Bezugsstelle näher liegt aber Jean-Jaques Rousseaus berühmte
"Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit
unter den Menschen" (1754). Dort heißt es im zweiten Teil:
Ein ungezähmtes Roß sträubt die Mähne, stampft auf
den Boden und schlägt ungestüm um sich, wenn man ihm
die Kandare anlegen will; ein zugerittenes Pferd hingegen
erträgt geduldig Sporen und Peitsche. So beugt auch ein
wilder Mensch sein Haupt nicht unter das Joch, das ein
zivilisierter ohne Murren erträgt, und dem Wilden ist eine
ungestüme Freiheit erwünschter als die friedvollste Untertänigkeit.
Am 28. August.
Der "Wetsteinische Homer" ist eine zweibändige
griechisch-lateinische Homer-Ausgabe des Amsterdamer Buchdruckers
J. H. Wetstein von 1707 im Duodez-Format, der "Ernestinische" (von
dem Leipziger Philologen Ernesti) hingegen eine fünfbändige
im Format Quart, erschienen 1759-1764 in Leipzig.
 |
|
Die Vorseiten oder Frontispize (eigentlich: Vordergiebel) der beiden
Homerausgaben im Größenvergleich. (Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel)
|
Am 30. August.
Am 3. September.
Am 10. September.
Am 20. Oktober 1771.
Am 26. November 1771.
Am 24. Dezember 1771.
Das "eherne und eiserne Jahrhundert" erklärt sich aus einer
Übertragung der in der Antike verbreiteten Vorstellung von vier
Weltzeitaltern (dem goldenen, silbernen, ehernen und eisernen)
auf das menschenliche Leben. Nach Ovids "Metamorphosen" ist das
eherne (= kupferne, bronzene) Zeitalter das der Künste und Kriege
und das eiserne das von Entbehrung und Arbeit.
Den 8. Januar 1772.
Am 20. Januar.
Den 8. Februar.
Am 17. Februar.
Am 20. Februar.
Den 15. März.
Wenn Werther liest, wie der der heimkehrende Odysseus von dem trefflichen
Schweinehirten aufgenommen und bewirtet wird, so liest er den 14. Gesang
der "Odyssee". Die Genugtuung, die er darüber empfindet, wie der als
Bettler verkleidete Ulyß (lateinisch für 'Odysseus') bei dem Schweinehirten
Eumaios Aufnahme findet, hat durchaus Bezug zu seiner eigenen Situation.
Der Bettler ist der heimliche König, und er sinnt bereits darauf, wie er
sich zu erkennen geben und sich seine Rechte zurückholen wird - so wie auch
Werther seine Verbannung aus der Adels-Gesellschaft nicht als das letzte Wort
über seinen gesellschaftlichen Rang verstehen will und kann.
Am 16. März.
Am 24. März.
Am 19. April.
Am 5. Mai.
Am 9. Mai.
Ulyß, der von der Unendlichkeit von Meer und Erde spricht -
ein letzter Hinweis auf die "Odyssee", deren schlichtes Weltbild
Werther zu seinen eigenen Vorstellungen aus Kindertagen einfällt.
Am 25. Mai.
Am 11. Junius.
Am 16. Junius.
Am 18. Junius.
Am 29. Julius.
Die "Stelle eines lieben Buches", wo sein und Lottes Gefühl
weit mehr als das von ihr und Albert übereinstimmen, erinnert
an ihr Gespräch auf der Fahrt zum Ball. Ein bestimmter Text
oder Autor ist hier aber nicht gemeint.
Am 4. August.
Am 21. August.
Am 3. September.
Am 4. September.
Am 5. September.
Am 6. September.
Am 12. September.
Am 15. September.
Außer über das Fällen der Bäume (siehe unter
KULTURELLES) erregt sich Werther
auch über die Gesinnung der Pfarrersfrau. Sie hat sich "in die Untersuchung
des Kanons meliert (=eingemischt)", d.h. sie hat sich der dazumal neuen,
rationalistisch-kritischen Bibellektüre verschrieben. Damit verstößt sie
gegen die emphatische Glaubensbereitschaft Werthers und überhaupt des
Sturm und Drang, die hier mit "Lavaters Schwärmereien" zitiert wird.
Johann Caspar Lavater (1741-1801) hatte in seinen "Aussichten in die
Ewigkeit" (1768-1773) ein Bild des himmlischen Paradieses entworfen,
wie es seiner Auffassung nach der Bibel zu entnehmen war. Die
rationalistische Bibelkritik hingegen verstand die Bibel nicht mehr
unmittelbar als 'Gottes Wort', sondern las sie als Geschichts- und
Geschichtenbuch des Judentums und wies ihr zunehmend sachlich-logische
Widersprüche nach. Neben den genannten Theologen Benjamin Kennicot
(1718-1783) und Johann Salomo Semler (1725-1791) sowie dem Orientalisten
Johann David Michaelis (1717-1791) hätten - nach 1774 - auch die von
Lessing veröffentlichten Reimarus-Fragmente genannt werden können,
die die radikalsten Angriffe jener Zeit auf die Glaubwürdigkeit der
Bibel enthielten. Bei aller Häme Werthers gegen die Pfarrersfrau und
ihre unsympathische Dürftigkeit sollte man also nicht übersehen, daß
sie im Unterschied zu ihm die zukünftigere Form des Bibel-Verständnisses
vertritt. -
Am 10. Oktober.
Am 12. Oktober.
Ossian hat Homer verdrängt - die bedeutungsvolle Hinwendung Werthers
zu der tragisch-dunklen Dichtung des Schotten MacPherson (1736-1796),
die dieser für die Übersetzung eines gälisches Heldenliedes aus dem 3.
Jahrhundert ausgab. Obwohl die Authentizität der 1762 und 1765
veröffentlichten Gesänge in England sofort bestritten wurde, nahm
die junge Generation in Europa sie begeistert auf. Goethe lernte
sie durch Herder in Straßburg kennen und übersetzte daraus die
"Gesänge von Selma", aus denen Werther Lotte dann auch vorliest.
Die Ossian-Dichtung ist hauptsächlich Toten-Klage. Hintergrund ist
der Abwehrkampf des schottischen Königs Fingal gegen den in Irland
eingedrungenen König von Skandinavien und der Heldentod der Verteidiger.
Der eigentliche Inhalt jedoch ist die feierlich-getragene Ausmalung
der Trauer, unterlegt mit schwermütigen Naturbildern, ein immer sich
wiederholendes Besingen von frühem Tod, unendlichem Schmerz und ewigem
Ruhm. Doch genau diese Stimmung war es, die der jungen Generation,
sonst nur mit der Forderung nach Mäßigung und Vernunft konfrontiert, so
gefiel. (Der eine Generation ältere Lessing etwa hat nie auch nur
ein Wort über den 'Ossian' verloren.) Es war dasselbe Bedürfnis, das dann
auch der Balladendichtung den Weg bahnte, d.h. zumal dem naturmagischen
Typus wie Goethes "Erlkönig", so als habe man der Aufklärung
das Hamlet-Wort entgegenhalten wollen, daß es 'mehr Dinge zwischen Himmel und Erde
gibt, als eure Schulweisheit sich träumen läßt'.
Um seine Fälschung zu verteidigen, arbeitete Macpherson sein ganzes
weiteres Leben an der Herstellung eines gälischen 'Originals', das zehn
Jahre nach seinem Tod aus seinem Nachlaß auch veröffentlicht wurde.
Die Zweifel an der Echtheit allerdings blieben, doch wurde erst am
Ende des 19. Jahrhunderts die Fälschung endgültig nachgewiesen.
Am 19. Oktober.
Am 26. Oktober.
Am 27. Oktober.
Am 30. Oktober.
Am 3. November.
Am 8. November.
Am 15. November.
In seiner Verzweiflung nimmt Werther hier mehrfach auf
Bibelstellen Bezug. Den Gedanken, daß ihm sein Schicksal,
seine Gottverlassenheit von Gott selbst bestimmt sein könnte,
übernimmt er aus dem Neuen Testament, Evangelium des Johannes.
Hier sagt Jesus zu Anhängern, die ihn um ein Wunder bitten,
damit sie ganz an ihn glauben könnten, daß nur Gott ihnen diesen
Glauben geben könne: "Niemand kann zu mir kommen, wenn es ihm
nicht vom Vater gegeben ist". (Kap.6, Vers 65). Der 'Kelch',
der selbst für Gottes Sohn zu bitter war, knüpft an an die von
Jesus im Garten Getsemane vor seiner Gefangensetzung gesprochenen
Worte, Gott möge diesen Kelch an ihm vorübergehen lassen
(Evangelium des Matthäus, Kap. 26, Vers 39). Und "Mein Gott!
Mein Gott! warum hast du mich verlassen? " sind die letzten
Worte von Jesus am Kreuz (Evangelium des Matthäus, Kap. 27, Vers 46).
Am 21. November.
Am 22. November.
Am 24. November.
Am 26. November.
Am 30. November.
Am 1. Dezember.
Am 4. Dezember.
Eine bestimmte Melodie ist für Lottes schon im Brief vom 16. Juli 1771
bezeichnetes Lieblingslied nicht erschließbar. Als Beispiel geben wir
einen Satz aus der Sonata c-moll von 1775 von Ernst Wilhelm Wolf (1735-1792) wieder.
Goethe hat in einem Brief an Johanna Fahlmer vom 23. November 1773
der 'beliebten Kompositionen' von Wolf auch gedacht.
Am 6. Dezember.
{BERICHTSTEIL I}
{BRIEFEINLAGE I)
{BRIEFEINLAGE II}
{BRIEFEINLAGE III}
{BERICHTSTEIL II}
{OSSIAN}
Die Ossian-Partien, die Werther zitiert, stammen aus dem Gedicht,
das bei MacPherson "Songs of Selma" heißt. 'Selma' ist eine Burg
oder ein Anwesen, wo sich die Barden, die die verstorbenen Helden
besingen, zum Wettstreit oder Austausch versammelt haben. Goethe
hatte selbst diese Partien 1771 aus dem Englischen übersetzt, hat
sie für den 'Werther' aber noch einmal deutlich umgeformt
(siehe unter
GESTALTUNG).
- Ossian teilt in den einzelnen Partien mit,
was jene Sänger auf Selma von den Helden berichtet haben. Die
Sängerin Minona 'zitiert' die Klage Colmas, deren Bruder und
deren Geliebter sich gegenseitig erschlagen haben. Der Sänger
Ullin läßt Ryno und Alpin sprechen, und dieser wiederum berichtet
von Armin, der um seine Tochter Daura und seinen Sohn Arindal
klagt. Daura glaubte sich von ihrem Geliebten Armar auf einer
Insel erwartet, war jedoch von ihrem Feind Erath irreführt worden.
Auf ihren Hilferuf eilten der Geliebte und der Bruder herbei, der
Geliebte tötete aus Versehen den Bruder und kam selbst in den Fluten
um. So blieb Daura hilflos auf der Insel allein und starb.
Die Verwandtschaft dieser Konstellationen mit der Werther-Handlung ist
nicht zu übersehen: sie handeln jeweils von Frauen, die ihren Geliebten
verlieren, und zugleich vom Tod des Geliebten. Daß aus Lottes Augen ein
'Strom von Tränen' bricht, als sie vom Schicksal der einsam sterbenden
Daura hört, ist ein Eingeständnis ihrer eigenen Verlassenheit, wenn
Werther sie verlassen wird, und entsprechend deutlich auch heißt es,
daß beide, Werther und Lotte, "ihr eigenes Elend in dem Schicksal
der Edlen" fühlten. - Die letzte Ossian-Passage "Warum weckst du mich,
Frühlingsluft?" stammt aus einem anderen Ossian-Lied, dem "Berrathon",
und gibt einen unmittelbaren Vorausblick auf Werthers Tod.
{ABSCHIED}
{ENDE}
Daß Priester und Levit an seiner Grabstelle vorbeigehen
und nur der Samariter eine Träne um ihn weinen würde, nimmt
noch einmal das schon am 12. August 1771 berührte Gleichnis
vom Barmherzigen Samariter (Neues Testament, Evangelium des
Lukas 10, Vers 30-35) auf. Werther sieht sich damit als ein Opfer,
dessen eben nur ein Samariter in Nächstenliebe gedenken würde, während
Priester und Levit selbstgerecht vorbeigingen. - Auch das Motiv vom
'Kelch', den er fassen will, weil er ihm von Lotte gereicht wird,
ist noch einmal eine Anlehnung an die Bibel. Jesus willigt in seine
Festnahme mit den Worten: Soll ich den Kelch nicht fassen, den mir
mein Vater gegeben hat? (Neues Testament, Evangelium des Johannes,
Kap. 18, Vers 11).
~~~~~~~~~~~~
Daß Werther die 1772 erstmals erschienene "Emilia Galotti" auf seinem
Pult aufgeschlagen liegen hat, ist mehr als nur eine Entlehnung aus
der Geschichte Karl Wilhelm Jerusalems, in dessen Sterbezimmer
ebenfalls Lessings Trauerspiel auf dem Lesepult vorgefunden wurde. Es
ist als ein Hinweis auch auf die Motive von Werthers Selbstmord zu
verstehen. Emilia, von dem Prinzen von Guastalla bedrängt, will
Selbstmord begehen, weil sie befürchtet, den Verführungsabsichten des
Prinzen nicht standhalten zu können. "Auch meine Sinne sind Sinne",
sagt sie zu ihrem Vater, "ich stehe für nichts. Ich bin für nichts
gut." (Emilia Galotti, 5. Aufzug, 7. Auftritt). So bittet sie den
Vater um seinen Dolch und fordert ihn, als er zögert, mit der
Ausmalung ihres Schicksals so heraus, daß er sie ersticht. Auf Werther
angewendet, bedeutet das, daß auch er sich seiner 'Sinne' nicht sicher
ist, fürchten muß, sich Lotte gegenüber schließlich doch nicht
beherrschen zu können, und ehe er sich in dieser Weise ihr und Albert
gegenüber ehrlos macht, will er wie Emilia lieber sterben.
 |
|
Das Titelblatt der im März 1772 erschienenen
Erstausgabe von Lessings Trauerspiel.
|