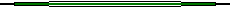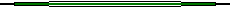|
Urteile und Deutungen /Erster Teil |
 |
 |
 |
 |
Allgemeines
Im Unterschied zu allen anderen Werken des etablierten Goethe wurden die Wahlverwandtschaften von einem nicht kleinen Teil der ersten Lesergeneration ausdrücklich missbilligt.
Dass in dem Roman die Liebe zwischen Eduard und Ottilie so verständnisvoll behandelt wird, war nach christlichen Begriffen ein Skandal. Noch zwanzig Jahre nach Goethes Tod sprach
Eichendorff tadelnd von einer "ausführlichen Geschichte geistigen Ehebruchs ... und es nützt wenig, daß zuletzt nach dem Gemeinspruch: 'wer nicht hören will, muß
fühlen', jedem Mitschuldigen sein tragisches Ende gehörig zugemessen wird".

Mit der Säkularisierung der Ehe verlor diese Kritik aber an Gewicht, und auch andere kritische Einwände verblassten. Die Wundertätigkeit der verstorbenen Ottilie, die
Unwahrscheinlichkeit der doppelten Ähnlichkeit des Kindes, das eigentlich Uneingelöste des chemischen Gleichnisses - je später je weniger ging man auf solche
einst beanstandete Stellen noch ein. Und nicht nur das. In der Idee, dass jedes Werk von Goethe vollkommen ist, begann man auch das vermeintlich
Unplausible tiefgründig zu bedenken, etwa das Tagebuch Ottilies, das demnach subtil ihre geheimsten Seelenregungen erkennen lassen soll.
Vor allem aber wurde der Roman in immer weiteren gedanklichen Brückenschlägen mit anderen Erkenntnissen verbunden, mythologischen,
philosophischen, sozialgeschichtlichen, sodass nicht selten zweifelhaft ist, was diese Beiträge eigentlich klären wollen. Der erste und zugleich
namhafteste von ihnen, der umfangreiche Essay "Die Wahlverwandtschaften" von Walter Benjamin aus dem Jahr 1924, galt ausdrücklich nicht dem "Sachgehalt" des
Romans, sondern seiner "Wahrheit", nicht seinem zeitlichen Wirken, sondern seinem "ewigen Sein". Gefunden hat Benjamin es im mythischen Urgrund des Geschehens, einer dunklen
Gebundenheit aller Beteiligten, von der sich nur die "wunderlichen Nachbarskinder" in heller Selbstbestimmtheit unterscheiden sollen.

Das mag sich vertreten lassen oder auch nicht - es ist nicht möglich, auf das Stimmengewirr aus solchen Überlegungen hier einzugehen. Es handelt sich dabei mehr um ein Sprechen
aus Anlass des Romans, als um ein Sprechen über ihn, wobei man oft genug den Eindruck hat, dass nicht die Genialität Goethes als vielmehr die der Interpreten damit vorgezeigt werden soll. Nur wo sich
Einzelnes markant auf bestimmte Textstellen beziehen lässt, wird deshalb auf solche Beiträge hingewiesen.
Eine Arbeit, weil sie gleich mehrere solcher Auslegungsrichtungen bündelt, soll allerdings genannt werden. Es ist Waltraut Wiethölters Abhandlung "Legenden. Zur Mythologie
von Goethes Wahlverwandtschaften". Nach ihrem Verständnis sind es drei Mythen, die dem Romangeschehen bedeutungserweiternd unterlegt sind. Der erste ist der Mythos von Narziss
und Echo. Narziss, der in sich selbst verliebte Jüngling, ist Eduard, die Nymphe Echo, die ihn liebt, aber nichts sagen, sondern nur "echoen" kann, ist Ottilie. In der Legende stirbt sie,
weil Narziss sie nicht erhört, und er, weil er sein im Wasser schwebendes Abbild nicht ergreifen kann. Die Wahlverwandtschaften lösen diesen Mythos nach Wiethölter
in viele Einzelmotive auf und zeigen auf diese Weise das Unfeste aller Sinnbezüge an, lassen "die Struktur des Textes noch deutlicher zutage treten".
Die zweite mythische Schicht ist die Marienlegende: Ottilie als christliche Heilige, die aber auch eine unheilvolle Eva ist, die erst durch ihren Verzicht auf einen Mann und
tiefe Selbsterkenntnis zu einer wahren Heiligen wird. Auch dieser Bezug stellt sich nach Wiethölter aber vielfach selbst in Frage, sodass die christliche Schlussbotschaft
des Romans keineswegs als dessen letzter Sinn verstanden werden darf.
Schließlich nimmt Wiethölter über das chemische Gleichnis hinaus einen großen alchimistischen Hintergrund in dem Roman wahr. Neben den vier Personen stehen die
vier Elemente, die vier Jahreszeiten, die vier Himmelsrichtungen, und es wohnen Männer und Frauen paarweise aufgeteilt auf des Schlosses rechtem und linkem Flügel. "Otto"
als Wort hat zudem genauso viele Buchstaben wie "Gott" und wird, mit dem heidnischen "Stein der Weisen" - lapis - verbunden, zu "Lotto", sodass Mittler mit seinem Lotteriegewinn
eigentlich Mephisto ist. Seine falsche Heilsbotschaft für das Kind Otto kostet den Pfarrer denn auch das Leben. Alles zusammen bewirkt, dass aus dem Roman wie in einem
alchimistischen Experiment ein ebenso wunderbares wie rätselhaftes poetisches Gleichnis wird.

Gustav Seibt und Oliver R. Scholz haben dem Fazit dieser Analyse, nämlich auf jede Sinnfestlegung für den Roman zu verzichten, entschieden widersprochen, auch wenn
sie deren Befunde nicht pauschal in Zweifel ziehen wollten. Dem ganzheitlichen Verstehen genüge eine "Doppelstruktur", machen sie geltend, eine Ebene des
bewussten Handelns der Romanfiguren einerseits und eine ihres hintergründigen Bestimmtseins andererseits.

So richtig das im Prinzip ist - ein viel grundsätzlicherer Einwand gegen das Motivausloten à la Wiethölter ergibt sich bei Seibt und Scholz aus einem
Nebenargument. Es ließen sich nur "viel zu geringe Teile des Romans" für eine dreifache mythologische Aufschlüsselung der
Handlung verwerten, wenden sie beiläufig ein. Und in der Tat: Nicht nur hier, sondern bei allen solchen Tiefschürfungen müssen neunzig Prozent des Textes als Abraum oder
Ballaststoff zur Seite gelegt werden, um die sogenannten "Früchte" zu bergen. Wozu ist der Roman dann da? Dass man das erzählte Geschehen
über die mythologische Grundierung besser begreift, wird nicht einmal von den Interpreten behauptet, und wer sich über Narziss und Echo, über Heiligenlegenden oder Alchimie
informieren möchte, wird sich ja wohl lieber anderen Büchern zuwenden.
Der einzige Zweck dieses Erschließungsaufwandes ist es, die Kunstqualität des Romans zu beweisen. Je mehr Anspielungen, Verknüpfungen, Hintersinnigkeiten darin
nachgewiesen werden können, desto besser soll das Werk sein. Dass sich Goethe alle diese Finessen und Spitzfindigkeiten tatsächlich ausgedacht hat, kann man mit guten Gründen
bezweifeln, hat er selbst sich doch schon über solchen Findefleiß lustig gemacht. "Im Auslegen seid frisch und munter! / Legt ihr's nicht aus, so legt was unter!" lautet ein Spruch aus den
Zahmen Xenien von 1821. Doch darauf kommt es nicht einmal an. Wichtiger ist: Selbst wenn er die Mehrfach-Symbolik in dem behaupteten Ausmaß in dem Roman angelegt hätte -
wäre das Ergebnis wirklich zu loben? Wird sein Werk dadurch eindringlicher, überzeugender, besser? Können uns gewisse Gezwungenheiten - die Ähnlichkeit der Namen, die Gleichheit
der Handschriften, das Aussehen des Kindes, Ottilies unverweslicher Leichnam usw. - dadurch interessanter werden? Schon bei den Zeitgenossen - und zumal den literarisch gebildeten - hat diese
Symbolik nicht funktioniert. Und heute sollen wir sie als große Kunstleistung bewundern? Es spricht nicht für die Literaturwissenschaft, dass sie das Vernunftgebot, dem sich jeder Nachdenkende eigentlich verpflichtet fühlen sollte, zugunsten einer sich selbst genügenden Gescheitheit so außer Acht lässt.

Erstes Kapitel
»... und wir dachten es uns so bequem, so artig, so gemütlich und heimlich, die Welt, die wir zusammen nicht sehen sollten, in der Erinnerung zu durchreisen. ... Dann hast du die
Abende deine Flöte wieder vorgenommen, begleitest mich am Klavier; und an Besuchen aus der Nachbarschaft und in die Nachbarschaft fehlt es uns nicht.«
Achim von Arnim schrieb am 5. November 1809 an seine spätere Frau Bettina über das Lebenskonzept von Eduard und Charlotte: "Diese Langeweile des unbeschäftigten, unbethätigten Glückes ... hat er [Goethe]
mit vieler Beobachtung in das Haus eines gebildeten Landedelmannes unserer Zeit einquartirt. Ich habe manchen der Art kennen gelernt, und alle leiden an einer ganz eigenthümlichen
Hypochondrie. Durch ihre Bildung von dem Kreise eigentlicher Landleute geschieden, ... ohne eine mögliche Richtung ihrer Thätigkeit zur allgemeinen Verwaltung kochen
sie ihre häusliche Suppe meist so lange über, bis nichts mehr im Topfe. Nirgends finden sich mehr Ehescheidungen als unter diesen Klassen."
Während Arnim anscheinend für möglich hält, dass Goethe solchen Lebensverhältnissen eine Mitschuld an dem
Unglück der Beteiligten geben will, mit anderen Worten: eine Art Gesellschaftskritik übt, wird in einer Tagebuchaufzeichnung von Eduard Meißner, Teplitzer Badearzt,
eine solche Absicht ausgeschlossen. Für ihn findet Goethe an diesem Milieu viel zu viel Gefallen, als dass er es tadeln wollte. "Schon dieser Titel! Welche
Affektation darin! ›Müßiggang, aller Laster Anfang‹ wäre ein passenderer." In der Tat kann von einer Infragestellung von Eduards
untätigem Wohlleben nicht die Rede sein. Wenn auf ihn kein so gutes Licht fällt, dann nur wegen seines Charakters. "Ich mag ihn selber nicht leiden", sagte
Goethe im Januar 1827 zu Eckermann, "aber ich musste ihn so machen, um das Faktum hervorzubringen. Er hat übrigens viele Wahrheit, denn man findet in den
höhern Ständen Leute genug, bei denen ganz wie bei ihm der Eigensinn an die Stelle des Charakters tritt."
Zweites Kapitel
Charlotte benutzte des andern Tags auf einem Spaziergang nach derselben Stelle die Gelegenheit, das Gespräch wieder anzuknüpfen,
vielleicht in der Überzeugung, dass man einen Vorsatz nicht sicherer abstumpfen kann, als wenn man ihn öfters durchspricht.
Für Peter Suhrkamp hat das gesamte Gesprächsverhalten der Beteiligten etwas Unnatürliches. "Etwas Praktisches zu besprechen; einen Wunsch zu äußern; rechtzeitig eine Warnung
zu geben oder eine notwendige Aufklärung, eine Zurechtweisung; einen Sachverhalt mitzuteilen; ja zu einer Sache sich mit einem einfachen Ja oder Nein zu stellen - davor besteht eine auffällige Scheu."
Den Grund sieht Suhrkamp darin, dass diese Gesellschaft "kein Verhältnis zum tätigen Leben und zu einer tätigen Welt hat. Äußerlichkeiten wie die, daß das Schloßpersonal so gut wie nicht vorhanden erachtet wird, oder die hochmütige Ablehnung, auf die Gestaltung der Verhältnisse bei den Bürgern des Ortes am Fuße des Schloßbergs einzuwirken, deuten zunächst
darauf hin."
In dieser Gesellschaft ist man sich deshalb auch nie sicher, was man kann, will, muss, und wird so zum Spielball zufälliger Einflüsse und Launen. Der Ausgang des Romans sei in dieser Hinsicht pessimistisch, als hätte Goethe den Untergang dieser Welt, als hätte er "den heutigen Weltzustand vorausgesehen. Und diese Ironie: eine Gesellschaft, die zum Gehalt ihres Lebens die Zivilisation gemacht hat, betreibt den Zusammenbruch der Zivilisation!" Dass Goethe an der Verstellung in der adligen Gesellschaft von Weimar selbst gelitten hat, ist zumal in seinen Briefen an Charlotte von Stein immer wieder zu lesen. Zugleich war er aber auch ein Teil dieser Gesellschaft und konnte sich eine Alternative zu ihr schwerlich vorstellen. Fraglich ist jedenfalls, wie nicht nur Suhrkamp es einschätzt, dass Ottilie demgegenüber ein Beispiel unverfälschter, wahrer Menschlichkeit sein soll.
Viertes Kapitel
»... ich würde hier niemals eine Wahl, eher eine Naturnotwendigkeit erblicken, und diese kaum; denn es ist am Ende
vielleicht gar nur die Sache der Gelegenheit. Gelegenheit macht Verhältnisse, wie sie Diebe macht; und wenn von Ihren Naturkörpern die Rede ist, so scheint
mir die Wahl bloß in den Händen des Chemikers zu liegen, der diese Wesen zusammenbringt. Sind sie aber einmal beisammen, dann gnade ihnen Gott!«
Was Charlotte hier wie in einer Vorahnung beschreibt, muss sie selbst am Schluss resignierend anerkennen:
»Es sind gewisse Dinge, die sich das Schicksal hartnäckig vornimmt. Vergebens, dass Vernunft und Tugend, Pflicht und alles Heilige sich ihm in den Weg stellen: es soll
etwas geschehen, was ihm recht ist, was uns nicht recht scheint; und so greift es zuletzt durch, wir mögen uns gebärden, wie wir wollen.«
Die in diesen Sätzen sich aussprechende Überzeugung, dass das zwischenmenschliche Verhalten und zumal die Liebe naturgegebenen Prägungen unterliegt, ist von
Anfang an als die Kernbotschaft der Wahlverwandtschaften begriffen worden. Im Gegensatz zu der Idee der Aufklärung, dass der Mensch sich selbst bestimmen kann und muss,
sah man hier das Bindungsbedürfnis für ganz und gar naturgesteuert erklärt. In einer von Goethe besonders geschätzten Rezension schreibt im Januar 1810
Bernhard Rudolf Abeken:
"Daß es Menschen gibt, die ihrer Natur nach verwandt sind, daß diese Verwandtschaft Liebe erzeugt ... ist das Thema fast aller Romane. ... Jeder Leser hat
dergleichen gesehn und erlebt; er wird bewegt und fühlt, daß auch er dem Loose unterworfen ist, welches die Liebe trifft. ... Hier sehen wir, wie dieselben ewigen Gesetze,
die in dem walten, was wir Natur nennen, auch über den Menschen ihre Herrschaft üben und ihm oft mit unwiderstehlicher Strenge gebieten; wie es nur eine, nur gesteigerte, Kraft ist, die leblose Stoffe zu einander zwingt und diesen Menschen zu einem andern zieht."

Wenn heute in der wissenschaftlichen Ergründung des Liebesgefühls Hormone und Botenstoffe separiert werden und womöglich noch mit Psychopharmaka experimentiert wird, wäre
Goethe über so viel Chemie allerdings doch wohl entsetzt. Das Gleichnis von Kalk und Schwefelsäure war ihm nur ein Symbol für etwas, das er sicherlich bis in alle Ewigkeit
der Natur als Geheimnis belassen wollte. In der letzten Konsequenz könnte solches Wissen nämlich ausschließen, was der Roman als 'Lösung' noch beibehält: des Menschen
- Ottilies - selbstbestimmten Verzicht.
Sechstes Kapitel
Den andern Morgen sagte Eduard zu Charlotten: »Es ist ein angenehmes, unterhaltendes Mädchen.« - »Unterhaltend?«, versetzte Charlotte mit Lächeln; »sie hat ja den Mund noch nicht aufgetan«.
Nach einer Mitteilung von B. R. Abeken hat Wieland über diese Stelle gesagt: "Für dieses Wort würde ich, wenn ich der Herzog wäre, Goethen ein Rittergut schenken". Das ist zumal deshalb bemerkenswert, als Wieland den Roman sonst in Bausch und Bogen verurteilt hat. Es sei, schreibt er im Juni 1810 in einem Brief, "ein desto tadelhafteres Kunstwerk", als nur die Nebensachen "für den Verdruß und Eckel an einer so bisarren, mit Inkonsequenzen, Unwahrscheinlichkeiten u. Ungereimtheiten so angefüllten, unsittlichen und scandalosen Geschichte einiger maßen entschädigen" könnten.
~~~~~~~~~~~~
Sie eilten, besonders
abends, nicht so bald von Tische weg. Charlotte bemerkte das wohl und ließ beide nicht unbeobachtet. Sie suchte zu erforschen, ob einer vor dem andern hiezu den Anlass gäbe;
aber sie konnte keinen Unterschied bemerken.
Für Isabella Kuhn ist das eine der ersten von vielen Stellen, an denen sich das grundsätzlich Böse in Charlottes Charakter zeigt. Anstatt sich über das geselligere
Verhalten der Männer zu freuen, lauere sie auf verborgene Absichten, heimliche Gründe, um möglicherweise Gegenmaßnahmen einleiten zu können. "Lautlos legt sich
das Netz haltloser, und doch verhaftender, den Anwesenden, Arglosen, verborgener und gerade in dieser Verheimlichung unbesieglicher Vorausverdächtigungen über den Raum und
spinnt die vier Personen erst recht ein. Der spinnengleiche, angstvolle Überwachungstrieb eines jede kleinste Veränderung wie den Tod fürchtenden ... gesicherten Ich zieht eben hier, da alles in schönster Ordnung ist, den dunklen Faden der Schuld ein."
Charlottes Motiv nach dieser Deutung: Sie will alles kontrollieren, damit es in den Grenzen des Üblichen bleibt. Ottilies natürliche Liebenswürdigkeit ist ihr ein Dorn im Auge, sie versucht sofort, ihr Verschiedenes an- und abzugewöhnen. Auch der Zuneigung Eduards zu Ottilie widersetzt sie sich nur, weil er sich damit ihrer Herrschaft entzieht, nicht weil sie ihn liebt. Sie brauchte nur in die Scheidung einzuwilligen, und alles könnte sich zum Guten wenden.

Ähnlich hat 1834 schon Bettina von Arnim in ihrem Erinnerungsbuch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde geurteilt. Selbst empfindlich gegenüber den Ansprüchen von Goethes Christiane schreibt sie zu den Wahlverwandtschaften: "Ich begreife nicht, warum sie alle sich unglücklich machen, warum sie alle einem tückischen Dämon mit stacheligem Szepter dienen; und Charlotte, die ihm täglich, ja stündlich Weihrauch streut, die mit mathematischer Konsequenz das Unglück für alle vorbereitet. Ist die Liebe nicht frei? - sind jene beiden nicht verwandt? - warum will sie es ihnen wehren, dies unschuldige Leben mit- und nebeneinander?"

Ist diese Deutung richtig? Trifft sie das mit dem Roman Gemeinte? Zweifellos tut sie das nicht. Charlotte soll uns nicht böse erscheinen, sie verhält sich
nur angemessen weiblich. "Nach Freiheit strebt der Mann, das Weib nach Sitte", heißt es in Goethes Torquato Tasso. Natürlich kann man schon die Sitte
an sich - in diesem Falle die der christlich unauflösbaren Ehe - für "böse" halten und folgern, dass der Roman in der Person Charlottes diese
Bösartigkeit erkennbar mache. Nur muss man hinzufügen, dass Goethe das nicht bezweckt hat. Hier wie überhaupt ist zwischen dem vom Autor Gemeinten
und dem zusätzlich Erkennbaren zu unterscheiden. Andernfalls läuft man Gefahr, außer der Autorintention auch sogar das seinerzeit Denkbare noch aus den Augen zu verlieren.
An einer Stelle tritt das bei
Isabella Kuhn auch ein. Gleich zu Beginn der Handlung wird über die Größe der Mooshütte gesprochen und geäußert,
sie sei für zwei doch geräumig genug, "
für einen Dritten ist auch wohl noch Platz".
Dazu Kuhn: "Man hätte erwartet: 'Für
ein Drittes - ist auch wohl noch Platz.' Ein Kind ist gleich ausgeschlossen." Alle Pläne, die das
Paar machte, verzichteten darauf, sich mit einem "neuen Leben" einzulassen. "Charlottens Kind ist hier eigentlich schon totgeboren." Dass es Zeiten gab, in
denen man Kinder nicht plante, sondern sie entweder bekam oder nicht bekam, scheint in Vergessenheit geraten zu sein. Und darüber hinaus: Ein ungeborenes
Kind war von vornherein nichts Kalkulierbares, sein Überleben lag wirklich "in Gottes Hand". Es wäre zu Goethes Zeiten nichts als sonderbar gewesen, würden Eduard und
Charlotte sich in der Mooshütte Gedanken darüber machen, dort auch demnächst ein gemeinsames Kind mit aufnehmen zu können. Goethes Christiane bekam fünf Kinder,
außer dem ersten starb jedes weitere kurz nach der Geburt.
Siebentes Kapitel
»... dass Sie unter Ihrem Gewand, auf Ihrer Brust ein Miniaturbild tragen. Es ist das Bild Ihres Vaters, des braven Mannes, den Sie kaum gekannt und der
in jedem Sinne eine Stelle an Ihrem Herzen verdient ...«
So offensichtlich es zu sein scheint, dass sich Eduard mit seiner Bitte um das Medaillon Ottilies Vater gewissermaßen aus den Augen schaffen will - die dekonstruktivistische
Durchleuchtung der Szene nach Jaques Lacan kommt zu einem anderen Ergebnis. Für Wolf Kittler will Eduard "an die Stelle des abwesenden Vaters" treten und damit die
Geliebte gerade vor seiner sexuellen Begierde schützen. "Denn mit dem Medaillon wird der Signifant des Begehrens, das heißt die phallische Funktion eliminiert. Indem er
selbst an die Stelle des Bildes tritt, das erotische Wünsche produziert, blockiert Eduard das eigene Begehren. Am Platz des Vaters wird das Verlangen des Körpers in ein
seelisches produziert. So wird Eduard zum Bild."

Zwar legt Eduard seinen Kopf nicht an Ottilies Brust und fragt sich ratlos nach seinem Begehren, wie man es hier angedeutet findet, in keiner einzigen Szene, doch kommt es dem
Dekonstruktivismus auf eine solche Beweisführung auch nicht an. Dem Roman soll das Abgeleitete nicht unbedingt entnommen werden können. Vielmehr genügt es, dass
es sich indizienhaft an ihm bestätigt. Man erfährt deshalb aus solchen Deutungen immer nur, was nach Lacan grundsätzlich gilt und vorauszusetzen ist, so wie man
aus dem Roman auch ableiten könnte, dass jeder Erdentag mit dem Morgen beginnt und mit dem Abend endet, auch wenn das nicht ausdrücklich gesagt wird.
Neuntes Kapitel
Sie löste darauf die goldne Kette vom Halse, an der das Bild ihres Vaters gehangen hatte, und legte sie mit leiser Hand über die anderen Kleinode hin, worauf
Eduard mit einiger Hast veranstaltete, dass der wohlgefugte Deckel sogleich aufgestürzt und eingekittet wurde.
Dass am Ende von einem "zarten Schlüssel an dem goldnen Kettchen" die Rede ist, mit dem Ottilie ihren Saffiankoffer verschließen kann
(siehe
ZWEITER TEIL, ACHTZEHNTES KAPITEL), hat zu der unbegreiflichen Annahme
geführt, es müsse sich um eben die Kette handeln, an der sie das Medaillon getragen hat und die sie in den Grundstein legt. Das ist bereits sprachlich
unbegründet, da es der Formulierung nach ein Schlüssel mit Kettchen ist und nicht eine gesonderte Kette, wie sie für das größere und schwerere Medaillon
benutzt worden ist. Selbst wenn man aber zu dieser Vermutung kommen sollte, wäre doch immer nur ein Versehen anzunehmen und nichts weiter daraus zu folgern.
Nicht so Bernhard Buschendorf und nach ihm weitere Ausleger. Ihnen zufolge handelt es sich bei dem Kettchen tatsächlich um die in den Grundstein eingemauerte Kette. Das
Lustgebäude soll nämlich eingestürzt und die Kette wieder ans Licht gekommen sein. Allerdings war es kein Einsturz "im Sinne einer
realen Zerstörung", sondern nur dem einer "virtuellen Aufhebung: das, wofür das Lusthaus steht, also die irdische Liebe", werde mit der Wiederbenutzung der Kette
symbolisch in Frage gestellt. Wie Ottilie an die Kette gekommen ist, wird nicht erklärt.

Als ob das nicht schon absurd genug wäre, wird auch noch die reale Ursache des virtuellen Gebäudeverlustes dingfest gemacht: bei dem Bau ist gepfuscht worden! Drei
Bedingungen werden
für ein Gelingen des Werkes bei der Grundsteinlegung aufgeführt: die Wahl des richtigen Bauplatzes durch den Bauherren, eine solide Gründung und eine sorgfältige
Ausführung. Gegen alle drei Grundsätze werde bei diesem Bau verstoßen. Erstens habe den Bauplatz nicht Eduard, sondern Ottilie ausgesucht. Zweitens sei der Grundstein
kein richtiger Kubus, da er "
an einer Seite unterstützt" werden müsse, und auch das ganze Fundament sei
nicht richtig angelegt worden, denn man habe an einer Ecke den Grund "
herausgeschlagen". Zuletzt sei auch noch der
von Charlotte unter den Stein geworfene "Kalk" als Bindemittel ungeeignet. Der dritte Verstoß: das Haus werde nicht fertiggestellt. Als Eduard und der Major nach längerer
Abwesenheit zurückkehren, sei es noch immer nicht verputzt, denn sie sähen dessen "
rote Ziegeln" in der
Höhe blinken.

Es könnte unnötig erscheinen, diese Bewertung zu widerlegen, aber sie wird übernommen und zum Beweis dafür herangezogen, "dass dieser Neubau, der im Unterschied zu dem
ererbten alten Schloss mit hohen Erwartungen befrachtet ... wird, zum Einsturz verurteilt ist".

Tatsächlich stimmt daran nichts. Selbstverständlich hat auch hier der Bauherr - Eduard - über den Bauplatz entschieden. Ottilie hat lediglich einen Vorschlag
gemacht. Für die Forderungsreihe des Gesellen - und allein um sie geht es - ist das aber unerheblich. Der Bauherr mag so oder so zu seiner Entscheidung gekommen sein, das
einzig Wichtige ist, dass das Gebäude "
am rechten Fleck" steht. Aus der Sicht der Maurer sollte das vor allem den
zuverlässigen Untergrund meinen. Hier wird die gewünschte Wohnlage betont, weshalb Eduard und Ottilie es nicht wagen, "
bei
diesen Worten einander anzusehen". Doch Zweifel an Eduards Einstehen für diesen Bauplatz gibt es nicht. Die Eile, mit der der Bau dann vorangetrieben wird, ist nicht
zu übersehen - aber werden dabei Fehler gemacht? Als im nachfolgenden Frühjahr das Haus in Augenschein genommen wird, erweist es sich in kurzer Zeit als bewohnbar.

Keller und Küche wurden
schnell eingerichtet ... So wohnten die Frauenzimmer mit dem Kinde nun oben, und von diesem Aufenthalt, als von einem neuen Mittelpunkt, eröffneten sich ihnen
unerwartete Spaziergänge. Sie genossen vergnüglich in einer höheren Region der freien, frischen Luft bei dem schönsten Wetter.
Auch die 'roten Ziegel', die Eduard und der Major in der Höhe blinken sehen, sind kein Zeichen für Unfertigkeit - es sind die Dachziegel, die das Sonnenlicht
reflektieren. Selbst noch der beanstandete Sachverhalt, dass ein Geselle durch die ganze Zeremonie der Grundsteinlegung führt, ist nicht fragwürdig. Schon damals
überließen die Meister solche öffentlichen Auftritte samt des Risikos, sich dabei zu blamieren, gern einem redegewandten Jüngeren. Die abgeleitete
Folgerung, das "Lustgebäude" sei wegen seiner zweckfreien Planung und Bestimmung einsturzgefährdet, wird durch kein einziges Textmoment bestätigt. Vielmehr:
es bewährt sich. Andernfalls müsste man als Erstes ja wohl fragen, wer die Bauleitung gehabt hat. Das ist der Hauptmann. Doch wer weiß, was noch ans
Licht kommt, wenn er erst einmal als der Hauptverantwortliche für die behaupteten Versäumnisse ausgemacht ist.
Siebzehntes Kapitel
Die Garderobe war im Schloss; dem verständigsten, genausten Knaben vertraute man die Aufsicht an; der Architekt leitete das Ganze, und ehe man sich's versah, so hatten die Knaben
alle ein gewisses Geschick. Man fand an ihnen eine bequeme Dressur, und sie verrichteten ihr Geschäft nicht ohne eine Art von Manöver.
Für
Richard Faber läuft diese ganze Veranstaltung auf eine paramilitärische Erziehung hinaus, so wie später ihr militärischer
Nutzen durch den Gehilfen ja auch gelobt wird (siehe
ZWEITER TEIL, SIEBENTES KAPITEL). Unverständlich erscheint ihm nur, dass Ottilie an dieser Einrichtung so offensichtlich Gefallen findet. Eigentlich müsste ihr wegen ihrer Internatserfahrung dieses kollektive Erziehungsmuster verdächtig sein. Goethe lässt nur eben hier wie in anderen Zusammenhängen mehr seine eigenen Überzeugungen sprechen, als an die Perspektive seiner Figuren zu denken.
| Urteile und Deutungen /Zweiter Teil |
Sechstes Kapitel
Und wer beschreibt auch die Miene der neugeschaffenen Himmelskönigin? Die reinste Demut, das liebenswürdigste Gefühl von Bescheidenheit bei einer großen,
unverdient erhaltenden Ehre, einem unbegreiflich unermesslichen Glück bildete sich in ihren Zügen ...
Für eine ganze Anzahl von Deutungen kommt in der Mariendarstellung Ottilies Wesen am reinsten zur Geltung. Entsprechend ihrer andauernden Kennzeichnung als das gute, das liebe,
das schöne Kind wird ein anbetungswürdig unschuldiges Mädchen in ihr gesehen, sodass man sie nach ihrem Tod zu Recht
wie eine Heilige verehrt. Gewisse Züge irdischer Weiblichkeit, so wenn sie Eduard das Wort von der "
Flötendudelei"
hinterbringt oder dass sie überhaupt auf dessen Werbung sich einlässt, fallen nicht ins Gewicht, zumal sie ja ihre Abirrung vom rechten Weg bereut und mit dem
Lebensverzicht büßt.
Eine sozial ausgerichtete Variante dieser Hochschätzung findet sich bei Peter Suhrkamp. Für ihn zeichnet sich Ottilie dadurch aus, dass sie sich allen
Konventionen entzieht und ein ganz sich selbst bestimmender Mensch bleibt. Bei allen anderen sind "Denken, Wirklichkeit, Leidenschaft, sind alle ursprünglichen Mächte
von der Natur abgelöst, aus ihrem Boden genommen, naturfremd". Ottilie hingegen ist "lebendige Natur", ein ganz und gar aufrichtiges Wesen, das nur dem eigenen Inneren folgt.
Dass Suhrkamp seinen Aufsatz 1944 während seiner Gestapohaft verfasst hat, mag zu dieser Bewertung beigetragen haben.

Ähnlich urteilt in einer materialistisch-marxistischen Ausrichtung Hans Jürgen Geerdts. Er sieht in Ottilie einen Menschen, der "in der Form naturhafter, elementarer
Verbundenheit mit den Ursprüngen eines lebensnahen Seins alle für Goethe erstrangigen Quellen der humanistischen Erneuerung" hütet. Sie "löst auf ihre durchaus
originelle Art ein gutes Teil der sie umgebenden Widersprüche" und zögert auch nicht, zuletzt ihr Leben zu opfern zur Bewahrung "wahrhafter Freiheit ihrer
menschlichen und weiblichen Existenz". Worauf das hinausläuft, sieht man an Geerdts Bewertung der Zofe Nanny. Diese vertritt ihm "in ihrer unverbildeten und unkonventionellen
Lebensart" jene Volkskräfte, die "immer wieder neue Quellen zur Verjüngung und Entwicklung der Nation wie einzelner sie vertretender Persönlichkeiten öffnen".
Kein Werk der Klassik, dem man in der DDR nicht eine sozialistische Perspektive nachzurühmen wusste - und sei es auch nur, damit es im Literaturkanon verblieb.

Für Susanne Konrad ist Ottilie demgegenüber ein Doppelwesen. "Eine 'Einheit' ist Ottilie höchstens in der Projektion, denn als literarische Gestalt zerfällt sie
in unvereinbare Komponenten. In manchen Textstellen ist sie als weibliche Imago- und als Geniusgestalt konzipiert, in anderen als junge Frau, als Subjekt." An dem Subjekt Ottilie wird eine
"unterbrochene Persönlichkeitsentwicklung" wahrgenommen. Schon weil sie arm und elternlos ist, traut sie sich wenig zu, und ihre Rolle im Pensionat macht sie nicht selbstsicherer.
So fühlt sie sich durch die Werbung Eduards aufgewertet, kann aber nicht angemessen mit ihr umgehen. Charlotte, die sie wie ein Kind behandelt, tut nichts, sie aus der Abhängigkeit
von Eduard und ihr selbst herauszuführen. Zuletzt kann sie sich dem Loyalitätskonflikt nur durch den Tod entziehen.
Diese personale Seite wird mit idealischen Momenten verbunden. Ottilie erinnert an die heilige Odilia und an die Jungfrau Maria, Legendengestalten, die sie für Eduard von
vornherein unerreichbar erscheinen lassen, sodass sie auch eigentlich keine Gefahr für dessen Ehe sein kann. Ein idealischer Zug ist ferner Ottilies naturmagische Veranlagung, und nicht
zuletzt ist es ihre geistige Reife. Wenn man bedenkt, dass sie bei ihren Spaziergängen mit dem Kind nur triviale Romane liest, ist es schlicht unerklärlich, wie sie zu den
tiefsinnigen Weltbetrachtungen ihres Tagebuches kommt. Das Resultat dieser Verbindung ist jedenfalls ein ins Überirdische entrückter, anbetungswürdiger Mensch, eine
himmlische Geliebte.
Susanne Konrad verallgemeinert diesen Befund zu Goethes Weiblichkeitsvorstellung überhaupt. Das Weibliche, das Faust "hinanzieht", ist "das Andere, das Ewige, das Unerreichbare",
weshalb auch "Gestalten wie Ottilie eine lebendige Persönlichkeitsentwicklung versagt bleibt". Gepaart mit Anspruchslosigkeit und Demut besitzt die ideale Frau alles,
was sie perfekt macht, von Anfang an. Das bedeutet aber auch: "Dort, wo sich in ihnen [den Frauen] das eigene Ich zu melden beginnt, und diese Rollenzuschreibung in Frage
zu stellen droht, darf es nicht entfaltet werden. Darüber wird der Schleier des schönen Todes gebreitet, um die Ordnung zu bewahren, die Herrschaft des Mannes zu sichern
und vor allem die Idee von der 'Unvergänglichkeit' zu schützen." Der Leichnam Ottilies verwest auch nicht, sondern er bleibt anbetungswürdig erhalten.

Wenn man sieht, zu welchen Elogen der Bewunderung sich ein Großteil der Sekundärliteratur zu Ottilie hat hinreißen lassen - noch 2010 wird sie "ein Geschenk des
Dichters an die Menschheit" genannt -, kann man nicht zweifeln, dass dieses Weiblichkeitsideal weit verbreitet war oder ist.
Auch wenn sich nicht notwendig ein "Machtanspruch des Patriarchats" darin beweisen muss, ist es doch gut, sich an einer solchen abweichenden Bewertung das durch
und durch Illusionäre der Ottilien-Gestalt bewusst zu machen.
Achtes Kapitel
Nun war er im Zuge, recht glänzend zu schließen, aber er bemerkte bald, dass der Alte, dem er das Kind hinhielt, sich zwar erst gegen dasselbe zu neigen schien, nachher aber
schnell zurücksank.
In der Beurteilung Mittlers ist sich die Sekundärliteratur einig. Er gilt als ein bornierter, anmaßender, ganz und gar unsensibler Rechthaber, so wie er hier den alten Pfarrer
nachgerade zu Tode spricht. Paul Stöcklein über ihn:
"Mittler ist unfreier als jede Gestalt des Romans und eigentlich leblos. ... Er hat fertige Lösungen für die Konflikte, die es geben kann. Er denkt und handelt fast maschinell. Die
Vorzüglichkeit seiner Grundsätze erspart ihm das wirkliche Eingehen auf die konkrete Situation, erspart ihm die Liebe. Er benutzt die christliche Lehre, um sich der
christlichen Pflicht zu entheben. - Seinem ahnungslosen Frevel, als die Phraseologie seiner Taufpredigt das Kind als Heiland des Hauses begrüßt, antwortet der Himmel
sofort auf mirakulöse Weise mit der Todesschickung. Er warnt die Menschen: Hütet euch vor diesem Menschen! Niemand versteht es. - Charlotte wird ihn weiter mit Mittlergeschäften beauftragen, deren jedes Unheil sät."
Zehntes Kapitel
Die wunderlichen Nachbarskinder. Novelle.
Bei der gewöhnlichen Auffassung, dass der kühne Schwimmer und Retter der Hauptmann ist, stellt sich die Frage, warum er dann unverheiratet geblieben und die Rettungstat mit einer
"
traurigen Erinnerung" für ihn verbunden ist.
Michael Niedermeier nimmt an, dass die Eltern des Mädchens
ihn abgelehnt haben, weil er zu arm war. Auch wenn das nicht besonders überzeugend ist, da beide Eltern einer "
künftigen Verbindung"
ihrer Kinder freudig entgegensehen, ist immerhin nicht auszuschließen, dass sich daran mit dem neuen Bräutigam etwas geändert hat. Ein direkter Widerspruch zum Text wird also vermieden.
Das gilt für die Lösung, die Wolf Kittler vorschlägt, nicht. Für ihn ist der Ausgang der Geschichte, also die Rettung des Mädchens, "ein Phantasma. So hätte es sein
sollen. Weil es aber nicht so war, will der Hauptmann nichts mehr davon wissen." Das Mädchen soll also ertrunken, "für ihn gestorben" sein.
Weil man für die Rolle des Hauptmanns lediglich das Wort 'Nachbarin' als Namensersatz (und nicht als Angabe zur Wohnsituation) lesen muss, um zu einer plausiblen Auflösung
zu kommen, liegt es viel näher, in ihm den düpierten Bräutigam zu sehen (siehe unter
GESTALTUNG zum
ZWEITEN TEIL, ELFTES KAPITEL).
Dreizehntes Kapitel
Sie springt in den Kahn, ergreift das Ruder und stößt ab ... Das Ruder entfährt ihr nach der einen Seite und, wie sie sich erhalten will, Kind und Buch nach der andern,
alles ins Wasser. Sie ergreift noch des Kindes Gewand; aber ihre unbequeme Lage hindert sie selbst am Aufstehen.
Goethes Zeitgenossen haben sich über den Ablauf des Unglücks keine Gedanken gemacht, nur der lakonische und dem Eindruck nach herzlose Bericht davon wurde hin und wieder beanstandet.
Es genügte anscheinend, dass ein junges Mädchen ein Ruderboot überhaupt bestieg, um jedes Unglück für möglich zu halten. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts änderte
sich das jedoch. Rudern wurde populär, als Sport wie als Freizeitvergnügen, und je mehr die Menschen damit ihre Erfahrungen machten, desto mehr verwunderte, was sich in der
betreffenden Szene abspielt.
Friedrich Spielhagen griff in seinem Aufsatz Die Wahlverwandtschaften und Effi Briest von 1896 die Diskussion darüber auf - sogar das Berliner Tageblatt hatte sich beteiligt -
und erklärte das Geschehen von Anfang bis Ende für unwahrscheinlich. Schon dass Eduard Ottilie beim Ablegen des Kahnes nicht hilft, ist ihm unbegreiflich, dann, dass sie mit dem Kind auf dem Arm in diesen hinein "springt" und schließlich sich stehend mit dem Kind mit einem der Ruder abzustoßen versucht - alles eigentlich unfasslich. Und warum kann sie das Kind nicht sofort bergen?
"Ein junges elastisches Mädchen ist doch keine unbehilfliche Matrone; das schnellt doch, unverletzt, wie sie selber ist, mag sie so 'unbequem' liegen, wie sie will, im Nu empor. Doch nein! »Die freie
rechte Hand ist nicht hinreichend, sich umzuwinden, sich aufzurichten; endlich gelingt's« - Endlich! Will sagen, nachdem das arme Kind, das nun einmal durchaus ertrinken sollte und mußte, ertrunken ist."

Noch sarkastischer hat sich Uwe Johnson 1980 in seiner Frankfurter Poetik-Vorlesung Begleitumstände über die Szene mokiert. Es sei wohl "vor allem das
starrsinnige Festhalten der Kindeshüterin an dem Buch" die Ursache des Unfalls gewesen, führt er aus, nur habe es sich leider nicht um eine unersetzbare Bibel oder die 'Beyträge zur Optik' in der Erstausgabe von 1791" gehandelt. Der "Regisseur und Autor der Szene" sei offenbar entschlossen gewesen, "an dieser Stelle einen Eingriff des Schicksals herbeizuführen, und notwendig muss es zu dem Unfall kommen genau so, wie er es verständnisvoll und unausweichlich vor uns ausbreitet."

Der ironische Umgang mit dieser Unzulänglichkeit läuft allerdings ins Leere, weil er außer Acht lässt, dass die erste Lesergeneration hier noch nichts auszusetzen fand. Spielhagen spricht das unbeabsichtigt aus, wenn er resümiert: "Sonderbar, daß noch niemand die Bemerkung gemacht hat, wie unsicher der auf dem Lande so sichre Goethe jedesmal wird, wenn er aufs Wasser kommt!" Eben, möchte man hinzufügen, weil diese Erfahrung ihm wie den meisten seiner Leser noch fehlte.
Siebzehntes Kapitel
So bewegte sich auch in dem täglichen Zusammenleben unserer Freunde fast alles wieder in dem alten Gleise. Noch immer äußerte
Ottilie stillschweigend durch
manche Gefälligkeit ihr zuvorkommendes Wesen, und so jedes nach seiner Art. Auf diese Weise zeigte sich der häusliche Zirkel als ein
Scheinbild des vorigen Lebens, und der Wahn, als ob noch alles beim Alten sei, war verzeihlich.
Eine Tochter Gottfried Körners, Emma Körner, schrieb im November 1809 in einem Brief aus Dresden, sie verstehe nicht nur nicht, dass Ottilie
gegenüber Charlotte kein schlechtes Gewissen habe, sie könne auch nicht begreifen, "wie vier Menschen, welche in einer so äußerst gespannten
Situation sind, als gegen Ende des Romans die vier Hauptpersonen sind, wie diese wieder ihr altes Leben vornehmen und ganz gelassen Clavier spielen
können".

Diese Äußerung einer Zwanzigjährigen, also einer anderen Ottilie, sollte einen zögern lassen, die geschilderten
Verhaltensweisen als "normal" oder "bezeichnend" für die damalige Zeit anzusehen. Burkhardt Lindner tut das, wenn er verallgemeinernd
erklärt, dass die 'bürgerliche Gesellschaft' - denn dafür steht ihm dieser Kreis - in dem Bemühen um humanen Takt aller
Wahrheit ausweicht und nur noch Verletzungen und Verstörungen hervorbringt. "Der Umgang der Gebildeten ist, weit entfernt Zwänge
aufzulösen, zu einem Mittel der Verstellung und der Verleugnung geworden."
Bürgerlich erzogene Menschen sahen in einem solchen Verhalten offenbar doch eher eine Deformierung als ein Beispiel für Selbstbeherrschung, und vielleicht hätte Goethe
das sogar verstanden. Irritierend ist nur, dass er das gemeinschaftliche Verdrängen "verzeihlich" nennt.
Achtzehntes Kapitel
Charlotte gab ihm seinen Platz neben Ottilien und verordnete, dass niemand weiter in diesem Gewölbe beigesetzt werde.
Unter dieser Bedingung machte sie für Kirche und Schule, für den Geistlichen und den Schullehrer ansehnliche Stiftungen.
Für
Richard Faber verstößt Charlotte damit eklatant gegen die von ihr vertretene Auffassung einer "endlichen allgemeinen Gleichheit, wenigstens nach dem Tode"
(siehe
ZWEITER TEIL, ERSTES KAPITEL), mit der sie im Vorjahr die Neuordnung des Friedhofs durchgesetzt hat.
Es beweist ihm, dass Goethe "seinen Elitarismus, der die Ständegesellschaft zur affirmativen Folie hat", über den egalitären Standpunkt Charlottes keineswegs in Frage stellen wollte.
In der Tat kann man wohl kaum die Figur - Charlotte - für das Sonderbegräbnis in Anspruch nehmen. Nicht nur fehlt jeder Hinweis darauf, dass sie sich an ihre frühere Einstellung zum Tod
erinnert, es würde auch zu nicht auflösbaren Widersprüchen führen, wenn ihr Meinungswechsel erklärt werden müsste. Am Ende könnte die herausgehobene Bestattung sogar
wie eine Verhöhnung der Toten aussehen. Man kann also nur folgern, dass Goethe diesen Schluss auf Charlotte hin nicht durchdacht hat.

Zu welch abenteuerlichen Folgerungen es führt, wenn man die Bestattung in der Kapelle von der Handlung trennt, zeigt sich bei Michael Mandelartz. Er nimmt eine
historische Sortierung der Gebäude des Romans vor und leitet aus ihr ein jeweils anderes Verhältnis des Menschen zur Welt ab. Für einen langen Zeitraum sieht er
eine Entwicklung hin zu immer mehr Harmonie. "Mühle, Kirche, Schloss und Mooshütte stehen noch in [einem] Zusammenhang kontinuierlicher Steigerung." Das neue
Lustgebäude hingegen bezeichne "den historischen Punkt, an dem die in sich selbst versenkte Subjektivität die Wirklichkeit aus dem Auge verliert". Man suche und bezwecke
nur noch das Schöne, löse das Ästhetische "aus dem Wirkungszusammenhang der Natur, und so folgt notwendig seine Erstarrung, der Tod".
Die selbstbezogenste, am meisten nur noch ästhetisch angelegte Figur ist ihm Ottilie, und ein Indiz dafür auch ihre Bestattung. Ihre Grablegung in einer gotischen
Kapelle bedeute "einen Rückgriff auf frühere historische Epochen, eine Regression innerhalb der an den Baukörpern ablesbaren Entwicklungsfolge". Durch ihre
Aufbahrung werde sie zu einem Menschen des Mittelalters oder gar des alten Ägypten, Beispiel für eine orientierungslos gewordene Moderne, die wieder zum Anfang der
"mühsamen Integration von Natur, Mensch und Kunst" zurückkehre. "Das Endprodukt der europäischen Zivilisation, das aufgeklärte Subjekt, fällt zurück
in die Barbarei."

Wollte man das alles mit Charlotte verbinden, die die Aufbahrung in der Kapelle schließlich arrangiert, würde es sich tatsächlich um nichts anderes handeln, als
dass sie das Paar bestraft. Sie, die immer das Praktische, Nützliche, Schickliche im Blick hat, ist gerade nicht der Mensch, sich auf eine rein ästhetische Weltsicht
einzulassen. Sie würde die beiden Toten dann geradezu höhnisch in einen "schönen" Wartezustand versetzen, von dem sie ganz genau weiß, dass er nie enden wird, eben weil die beiden nicht "dereinst wieder zusammen erwachen". Zweifellos hat das aber der Erzähler, hat das Goethe nicht gemeint. Gemeint ist vielmehr, dass es eine Liebe gibt,
die den Tod überdauert.