| Die Ardenne-Geschichte |  |
 |
 |
 |
 Als Fontanes "Effi Briest" im Oktober 1894 in der "Deutschen Rundschau" zu
erscheinen begann, hat kaum jemand wahrgenommen, dass der Roman ein
tatsächliches Ereignis zum Ursprung hatte: den Ehebruchs- und
Duellfall im Hause Ardenne. Das ist auch nicht verwunderlich. Duelle mit
tödlichem Ausgang kamen damals immer wieder vor, und das Ardenne-Duell
lag zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre zurück und hatte keineswegs
besonderes Aufsehen erregt. Auch Fontane, obwohl zum Zeitpunkt des Geschehens
in Berlin und eifriger Zeitungsleser, hatte es nicht registriert, erst zwei Jahre
später erfuhr er zufällig in einem Gespräch davon. (Weiteres siehe
unter ENTSTEHUNG)
Nur Eingeweihte wussten also von diesem
Zusammenhang, und dabei sollte es noch lange bleiben. Zwar wurden 1909/10 die
beiden Briefe Fontanes veröffentlicht, die die Herkunft des
Effi-Briest-Stoffes anzeigten (siehe ENTSTEHUNG) ,
aber der Name Ardenne erschien
darin nur als "A." und wurde nicht kommentiert. Ebenso unterblieb die Namensnennung
wenig später in einer größeren Untersuchung zur Entstehungsgeschichte
des Romans. Die Verfasserin wusste zwar, um wen es sich bei 'A.' handelte, und
kannte Einzelheiten, ließ es aber bei Andeutungen bewenden. Ardenne und die
von ihm geschiedene Frau lebten noch, es hätte sogar rechtlich bedenklich
sein können, sie öffentlich mit dem Romangeschehen in Verbindung zu
bringen.
Als Fontanes "Effi Briest" im Oktober 1894 in der "Deutschen Rundschau" zu
erscheinen begann, hat kaum jemand wahrgenommen, dass der Roman ein
tatsächliches Ereignis zum Ursprung hatte: den Ehebruchs- und
Duellfall im Hause Ardenne. Das ist auch nicht verwunderlich. Duelle mit
tödlichem Ausgang kamen damals immer wieder vor, und das Ardenne-Duell
lag zu diesem Zeitpunkt bereits acht Jahre zurück und hatte keineswegs
besonderes Aufsehen erregt. Auch Fontane, obwohl zum Zeitpunkt des Geschehens
in Berlin und eifriger Zeitungsleser, hatte es nicht registriert, erst zwei Jahre
später erfuhr er zufällig in einem Gespräch davon. (Weiteres siehe
unter ENTSTEHUNG)
Nur Eingeweihte wussten also von diesem
Zusammenhang, und dabei sollte es noch lange bleiben. Zwar wurden 1909/10 die
beiden Briefe Fontanes veröffentlicht, die die Herkunft des
Effi-Briest-Stoffes anzeigten (siehe ENTSTEHUNG) ,
aber der Name Ardenne erschien
darin nur als "A." und wurde nicht kommentiert. Ebenso unterblieb die Namensnennung
wenig später in einer größeren Untersuchung zur Entstehungsgeschichte
des Romans. Die Verfasserin wusste zwar, um wen es sich bei 'A.' handelte, und
kannte Einzelheiten, ließ es aber bei Andeutungen bewenden. Ardenne und die
von ihm geschiedene Frau lebten noch, es hätte sogar rechtlich bedenklich
sein können, sie öffentlich mit dem Romangeschehen in Verbindung zu
bringen.
 So vergingen noch mehr als 50 Jahre, bevor der heute überall zitierte
Stoffhintergrund erstmals öffentlich dargelegt wurde. Ein
Enkel des Ardenne'schen Paares, der Physiker und Raketenbauer Manfred von
Ardenne (1907-1997), gewährte einem Literaturhistoriker Zugang zu
seinem Familienarchiv, und so sah sich jedenfalls die Fachwelt von da an unterrichtet.
Mehr allerdings auch nicht, da die Veröffentlichung so unauffällig
wie möglich erfolgte. Gedruckt in einer 'Studien'-Sammlung der
(Ost-)Berliner Akademie der Wissenschaften und getarnt als Vergleich
mit Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib" (siehe unter
WIRKUNG), dem derselbe Stoff zugrunde liegt,
sollte die Publikation ersichtlich jedes Aufsehen vermeiden. Autor
und Herausgeber befürchteten offenbar Einwände gegen diese
unproletarische Materie, und so beschränkte sich der Aufsatz
auch weitgehend auf den Nachweis von Parallelen zwischen der Lebensgeschichte
Elisabeth von Ardennes und den Romanen Spielhagens und Fontanes.
So vergingen noch mehr als 50 Jahre, bevor der heute überall zitierte
Stoffhintergrund erstmals öffentlich dargelegt wurde. Ein
Enkel des Ardenne'schen Paares, der Physiker und Raketenbauer Manfred von
Ardenne (1907-1997), gewährte einem Literaturhistoriker Zugang zu
seinem Familienarchiv, und so sah sich jedenfalls die Fachwelt von da an unterrichtet.
Mehr allerdings auch nicht, da die Veröffentlichung so unauffällig
wie möglich erfolgte. Gedruckt in einer 'Studien'-Sammlung der
(Ost-)Berliner Akademie der Wissenschaften und getarnt als Vergleich
mit Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib" (siehe unter
WIRKUNG), dem derselbe Stoff zugrunde liegt,
sollte die Publikation ersichtlich jedes Aufsehen vermeiden. Autor
und Herausgeber befürchteten offenbar Einwände gegen diese
unproletarische Materie, und so beschränkte sich der Aufsatz
auch weitgehend auf den Nachweis von Parallelen zwischen der Lebensgeschichte
Elisabeth von Ardennes und den Romanen Spielhagens und Fontanes.
 Wegen der Verstecktheit dieser Publikation dauerte es nochmals zwanzig Jahre,
bis der Stoff wirklich in der Öffentlichkeit ankam. Zwar wurde auf den
Ardenne-Fall in der wissenschaftliche Fontane-Literatur in Ost wie West mehr
und mehr hingewiesen, doch erst die 1984 in Berlin (West) erscheinende
Elisabeth-von-Ardenne-Biographie von Horst Budjuhn - "Fontane nannte sie 'Effi
Briest'" - machte ihn im Ganzen den Lesern bekannt. Auch Budjuhn hatte Zugang
zu dem Ardenne'schen Familienarchiv erhalten - seiner eigenen Überzeugung
nach als Erster -, und er konnte zumal auch eine Reihe von Bildern in seinem
Buch wiedergeben. Allerdings ging er mit seinem Material reichlich sorglos um.
Früher schon als Drehbuch-Autor für einen "Effi-Briest"-Film tätig
geworden (Näheres siehe unter
WIRKUNG), sah er im 'Bearbeiten' seines
Stoffes offenbar kein Problem und mischte nach Gutdünken frei Erfundenes
mit unter. Seitenlang werden hier Gespräche zwischen den Beteiligten
wiedergegeben, für die es an jedem Beleg fehlt, ja selbst eine Reichstagsdebatte
stattet er mit erfundenen Redebeiträgen aus. Davon abgesehen strotzt das Buch
von Detailfehlern wie falschen Daten, falschen Altersangaben, widersprüchlichen
Verweisungen usw.
Wegen der Verstecktheit dieser Publikation dauerte es nochmals zwanzig Jahre,
bis der Stoff wirklich in der Öffentlichkeit ankam. Zwar wurde auf den
Ardenne-Fall in der wissenschaftliche Fontane-Literatur in Ost wie West mehr
und mehr hingewiesen, doch erst die 1984 in Berlin (West) erscheinende
Elisabeth-von-Ardenne-Biographie von Horst Budjuhn - "Fontane nannte sie 'Effi
Briest'" - machte ihn im Ganzen den Lesern bekannt. Auch Budjuhn hatte Zugang
zu dem Ardenne'schen Familienarchiv erhalten - seiner eigenen Überzeugung
nach als Erster -, und er konnte zumal auch eine Reihe von Bildern in seinem
Buch wiedergeben. Allerdings ging er mit seinem Material reichlich sorglos um.
Früher schon als Drehbuch-Autor für einen "Effi-Briest"-Film tätig
geworden (Näheres siehe unter
WIRKUNG), sah er im 'Bearbeiten' seines
Stoffes offenbar kein Problem und mischte nach Gutdünken frei Erfundenes
mit unter. Seitenlang werden hier Gespräche zwischen den Beteiligten
wiedergegeben, für die es an jedem Beleg fehlt, ja selbst eine Reichstagsdebatte
stattet er mit erfundenen Redebeiträgen aus. Davon abgesehen strotzt das Buch
von Detailfehlern wie falschen Daten, falschen Altersangaben, widersprüchlichen
Verweisungen usw.
 Zehn Jahre später wurde das Ardenne-Material dann aber zum Glück
noch einmal seriös ausgewertet, und so liegt mit Manfred
Frankes "Leben und Roman der Elisabeth von Ardenne" seither auch eine
verlässliche Darstellung vor. Dass man sich heute wie selbstverständlich
auf diesen Ursprung der "Effi-Briest"-Geschichte berufen kann, ist im wesentlichen
Manfred Franke zu danken, und zwar auch zumal deshalb, als er sich nicht
nur sachlich korrekt, sondern auch kritisch mit den persönlichen
Bekenntnissen der Beteiligten auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass man
allen seinen Annahmen oder Vermutungen folgen muss. Doch werden
Quellenbefund und Interpretation hier stets so deutlich unterschieden, dass
man sich auch ein eigenes Urteil bilden kann. Die nachfolgende Darstellung, dem
Romangeschehen kapitelweise gegenübergestellt, ist hauptsächlich
dieser Arbeit verpflichtet, und soweit keine anderen Quellen benannt sind,
ist immer auf sie Bezug genommen.
Zehn Jahre später wurde das Ardenne-Material dann aber zum Glück
noch einmal seriös ausgewertet, und so liegt mit Manfred
Frankes "Leben und Roman der Elisabeth von Ardenne" seither auch eine
verlässliche Darstellung vor. Dass man sich heute wie selbstverständlich
auf diesen Ursprung der "Effi-Briest"-Geschichte berufen kann, ist im wesentlichen
Manfred Franke zu danken, und zwar auch zumal deshalb, als er sich nicht
nur sachlich korrekt, sondern auch kritisch mit den persönlichen
Bekenntnissen der Beteiligten auseinandersetzt. Das bedeutet nicht, dass man
allen seinen Annahmen oder Vermutungen folgen muss. Doch werden
Quellenbefund und Interpretation hier stets so deutlich unterschieden, dass
man sich auch ein eigenes Urteil bilden kann. Die nachfolgende Darstellung, dem
Romangeschehen kapitelweise gegenübergestellt, ist hauptsächlich
dieser Arbeit verpflichtet, und soweit keine anderen Quellen benannt sind,
ist immer auf sie Bezug genommen.

 Elisabeth von Plotho wurde am 26. Oktober 1853 in Zerben bei Parey geboren,
30 km nordöstlich von Magdeburg an der Elbe. Die von Plothos waren
märkischer Uradel, seit 1643 Reichsfreiherren und wegen ihrer langen
Ahnenreihe eine sehr standesbewusste Familie. In der Adels-Hierarchie stehen
sie mithin höher als die Briests in Fontanes Roman, waren aber wie diese
Gutsbesitzer und lebten von der Landwirtschaft.
Elisabeth von Plotho wurde am 26. Oktober 1853 in Zerben bei Parey geboren,
30 km nordöstlich von Magdeburg an der Elbe. Die von Plothos waren
märkischer Uradel, seit 1643 Reichsfreiherren und wegen ihrer langen
Ahnenreihe eine sehr standesbewusste Familie. In der Adels-Hierarchie stehen
sie mithin höher als die Briests in Fontanes Roman, waren aber wie diese
Gutsbesitzer und lebten von der Landwirtschaft.

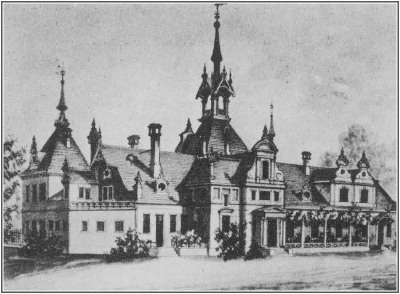 |
|
Das Stammhaus der Familie von Plotho in
Zerben an der Elbe (30 km nordöstlich von Magdeburg).
|
 |
|
Ein Rest des 1945 abgerissenen Schlosses
|
 Gänzlich anders allerdings waren die Familienverhältnisse. Die Eltern
des Effi-Vorbildes Elisabeth - oder Else, wie sie genannt wurde - waren gleichaltrig
und schon verheiratet, bevor Armand von Ardenne auch nur geboren war, so dass
ein früheres Neigungsverhältnis zwischen ihm und seiner Schwiegermutter
überhaupt nicht infrage kommt. Und Elisabeth war auch kein Einzelkind, sondern
jüngstes von fünf Geschwistern, vier Schwestern und einem Bruder.
Gänzlich anders allerdings waren die Familienverhältnisse. Die Eltern
des Effi-Vorbildes Elisabeth - oder Else, wie sie genannt wurde - waren gleichaltrig
und schon verheiratet, bevor Armand von Ardenne auch nur geboren war, so dass
ein früheres Neigungsverhältnis zwischen ihm und seiner Schwiegermutter
überhaupt nicht infrage kommt. Und Elisabeth war auch kein Einzelkind, sondern
jüngstes von fünf Geschwistern, vier Schwestern und einem Bruder.

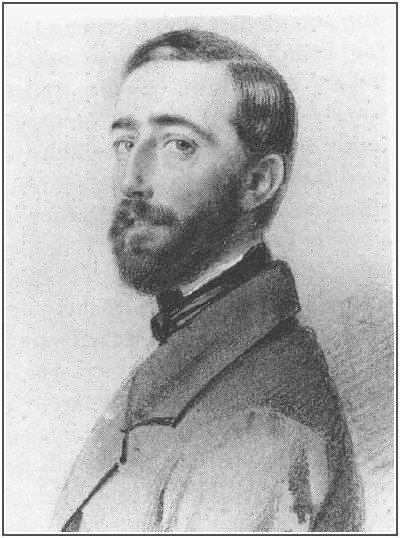 |
|
Felix Otto Waldemar Edler Herr und Freiherr von Plotho
(1822-1864)
|
 |
|
Maria von Plotho, geborene von Welling (1822-1897)
|
 Als der junge Ardenne in den Gesichtskreis der Familie trat, war Elisabeths Mutter
bereits Witwe und hielt für ihre vier Töchter natürlich nach
Heiratskandidaten Ausschau. Ihr Sohn wurde deshalb ermutigt, aus seiner Militärzeit
bei den Ziethen-Husaren in Rathenow immer wieder Kameraden mit nach Zerben zu bringen, und unter
ihnen war auch der am 26. August 1848 in Leipzig geborenen Armand von Ardenne.
Fünf Jahre älter als die damals erst 14-jährige Elisabeth, schien er
auf längere Sicht für eine Verbindung infrage zu kommen, und so lud
ihn die Mutter zu weiteren Besuchen ein.
Als der junge Ardenne in den Gesichtskreis der Familie trat, war Elisabeths Mutter
bereits Witwe und hielt für ihre vier Töchter natürlich nach
Heiratskandidaten Ausschau. Ihr Sohn wurde deshalb ermutigt, aus seiner Militärzeit
bei den Ziethen-Husaren in Rathenow immer wieder Kameraden mit nach Zerben zu bringen, und unter
ihnen war auch der am 26. August 1848 in Leipzig geborenen Armand von Ardenne.
Fünf Jahre älter als die damals erst 14-jährige Elisabeth, schien er
auf längere Sicht für eine Verbindung infrage zu kommen, und so lud
ihn die Mutter zu weiteren Besuchen ein.
 Keine Rolle spielte anscheinend Ardennes geringere Herkunft. Seine Familie stammte aus
Lothringen, gehörte nur dem niederen Adel an und war für die von Plothos
eigentlich 'unter Stand'. Zwar hatte Armands Vater als belgischer Generalkonsul im
Königreich Sachsen das Baronat erhalten, musste aber noch bis 1871 darauf warten,
dass der belgische König es auch seinen Nachkommen zugestand. Als Armand von Ardenne
im Hause der Plothos auftauchte, war er also nichts als ein einfacher Fähnrich,
d.h. Offiziers-Anwärter, der mit seinem Interesse an der jungen Elisabeth sogar in
Verdacht kommen konnte, nur seiner eigenen Karriere nützen zu wollen. Aufstiege
in Militär wie Politik hingen damals nicht unwesentlich auch von den Familien der Ehefrauen
ab, selbst Bismarck klagte mitunter darüber, das der Einfluss der Minister-Gattinnen
auf Personalentscheidungen zu groß sei. Frau von Plotho jedoch gefiel der junge Mann,
sein bescheidenes, mitunter sogar gehemmtes Auftreten versprach Solidität,
und bei der Lage ihrer Familie, dem Haus ohne Vater und den wenig günstigen
wirtschaftlichen Aussichten, erschien es ihr ratsam, die Töchter möglichst früh
und möglichst sicher zu verheiraten.
Keine Rolle spielte anscheinend Ardennes geringere Herkunft. Seine Familie stammte aus
Lothringen, gehörte nur dem niederen Adel an und war für die von Plothos
eigentlich 'unter Stand'. Zwar hatte Armands Vater als belgischer Generalkonsul im
Königreich Sachsen das Baronat erhalten, musste aber noch bis 1871 darauf warten,
dass der belgische König es auch seinen Nachkommen zugestand. Als Armand von Ardenne
im Hause der Plothos auftauchte, war er also nichts als ein einfacher Fähnrich,
d.h. Offiziers-Anwärter, der mit seinem Interesse an der jungen Elisabeth sogar in
Verdacht kommen konnte, nur seiner eigenen Karriere nützen zu wollen. Aufstiege
in Militär wie Politik hingen damals nicht unwesentlich auch von den Familien der Ehefrauen
ab, selbst Bismarck klagte mitunter darüber, das der Einfluss der Minister-Gattinnen
auf Personalentscheidungen zu groß sei. Frau von Plotho jedoch gefiel der junge Mann,
sein bescheidenes, mitunter sogar gehemmtes Auftreten versprach Solidität,
und bei der Lage ihrer Familie, dem Haus ohne Vater und den wenig günstigen
wirtschaftlichen Aussichten, erschien es ihr ratsam, die Töchter möglichst früh
und möglichst sicher zu verheiraten.
 Nicht so allerdings dachte Elisabeth selbst. Auf dem Gutshof an ein freies und unkompliziertes
Leben gewöhnt, wollte sie von einer frühen Heirat nichts wissen, und der ihr
ausgesuchte Bewerber gefiel ihr schon gar nicht. Noch als Fünfzehnjährige
schleppte sie einen ganzen Tross von Bauernjungen als Spielgefährten hinter sich her
und war nichts als ärgerlich, wenn es hieß, sie möge in den Salon kommen,
'der junge Ardenne spiele Klavier'. Bei einer solchen Gelegenheit war es dann wohl auch,
dass die Spielkameraden am Fenster auftauchten und hineinriefen "Else, komm!", was Fontane später
mit dem Verlobungs-Moment verband oder was ihm für diesen so berichtet worden
war. (Weiteres siehe unter WIRKUNG)
Nicht so allerdings dachte Elisabeth selbst. Auf dem Gutshof an ein freies und unkompliziertes
Leben gewöhnt, wollte sie von einer frühen Heirat nichts wissen, und der ihr
ausgesuchte Bewerber gefiel ihr schon gar nicht. Noch als Fünfzehnjährige
schleppte sie einen ganzen Tross von Bauernjungen als Spielgefährten hinter sich her
und war nichts als ärgerlich, wenn es hieß, sie möge in den Salon kommen,
'der junge Ardenne spiele Klavier'. Bei einer solchen Gelegenheit war es dann wohl auch,
dass die Spielkameraden am Fenster auftauchten und hineinriefen "Else, komm!", was Fontane später
mit dem Verlobungs-Moment verband oder was ihm für diesen so berichtet worden
war. (Weiteres siehe unter WIRKUNG)

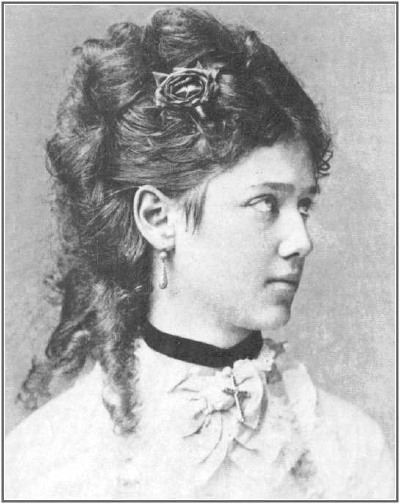 |
|
Else von Plotho als junges Mädchen
|
 An eine Verlobung jedoch war noch lange nicht zu denken. Die in lockeren Abständen
sich wiederholenden Besuche Ardennes konnten auch bei der 16-jährigen Elisabeth
einen Sinneswandel nicht bewirken, so offensichtlich es immer war, dass jedenfalls der
Mutter der junge Fähnrich gefiel. Vielmehr sah sich diese sogar gezwungen,
Ardenne um eine Einstellung seiner Besuche zu bitten: Elisabeth werde schon überall
als verlobt ausgerufen und könne einen Nachteil davon haben, wenn sie es immer länger
immer weniger wäre. Ardenne gab aber auch da noch nicht auf. Da Elisabeth in seiner Gegenwart
geäußert hatte, allzu hartnäckige, allzu unbelehrbare Bewerber brauchten sich
nicht zu wundern, wenn sie am Ende einen kränkenden Korb erhielten, ließ er
über einen Freund bei ihr anfragen, ob sie damit ihn gemeint habe, und bekam die
entsprechende Antwort. Damit schien seine Bemühung um sie unwiderruflich gescheitert
- von der Willfährigkeit einer Effi Briest in dieser Frage ist Elisabeth
von Plotho weit entfernt.
An eine Verlobung jedoch war noch lange nicht zu denken. Die in lockeren Abständen
sich wiederholenden Besuche Ardennes konnten auch bei der 16-jährigen Elisabeth
einen Sinneswandel nicht bewirken, so offensichtlich es immer war, dass jedenfalls der
Mutter der junge Fähnrich gefiel. Vielmehr sah sich diese sogar gezwungen,
Ardenne um eine Einstellung seiner Besuche zu bitten: Elisabeth werde schon überall
als verlobt ausgerufen und könne einen Nachteil davon haben, wenn sie es immer länger
immer weniger wäre. Ardenne gab aber auch da noch nicht auf. Da Elisabeth in seiner Gegenwart
geäußert hatte, allzu hartnäckige, allzu unbelehrbare Bewerber brauchten sich
nicht zu wundern, wenn sie am Ende einen kränkenden Korb erhielten, ließ er
über einen Freund bei ihr anfragen, ob sie damit ihn gemeint habe, und bekam die
entsprechende Antwort. Damit schien seine Bemühung um sie unwiderruflich gescheitert
- von der Willfährigkeit einer Effi Briest in dieser Frage ist Elisabeth
von Plotho weit entfernt.
