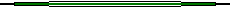| Die Wirkungsgeschichte des Romans |
 |
 |
 |
 |
 Ein halbes Jahr nach dem Abschluss des Vorabdrucks in der "Deutschen Rundschau"
erschien "Effi Briest" im Herbst 1895 als Buch. Fontane hatte den Roman dem noch
jungen Verlag seines Sohnes Friedrich überlassen, der sich in den Jahren davor
schon die Rechte an mehreren früheren Werken des Vaters erworben hatte. Eigentlich
hatte er diese geschäftliche Verbindung nicht gewollt. "Es wäre ja
fürchterlich", so hatte er den Sohn noch Anfang 1891 beschieden, "wenn
die gesunde Basis eines Verlagsgeschäfts immer ein bücherschreibender
Vater sein müßte". Mit "Effi Briest" gelang Friedrich Fontane dann aber
der Durchbruch. Bereits im ersten Jahr erreichte das Buch fünf Auflagen - die
Auflagenhöhe lag damals gewöhnlich bei 2000 bis 3000 Exemplaren -,
und wurde damit auch für Fontane selbst der größte von ihm
erlebte Erfolg.
Ein halbes Jahr nach dem Abschluss des Vorabdrucks in der "Deutschen Rundschau"
erschien "Effi Briest" im Herbst 1895 als Buch. Fontane hatte den Roman dem noch
jungen Verlag seines Sohnes Friedrich überlassen, der sich in den Jahren davor
schon die Rechte an mehreren früheren Werken des Vaters erworben hatte. Eigentlich
hatte er diese geschäftliche Verbindung nicht gewollt. "Es wäre ja
fürchterlich", so hatte er den Sohn noch Anfang 1891 beschieden, "wenn
die gesunde Basis eines Verlagsgeschäfts immer ein bücherschreibender
Vater sein müßte". Mit "Effi Briest" gelang Friedrich Fontane dann aber
der Durchbruch. Bereits im ersten Jahr erreichte das Buch fünf Auflagen - die
Auflagenhöhe lag damals gewöhnlich bei 2000 bis 3000 Exemplaren -,
und wurde damit auch für Fontane selbst der größte von ihm
erlebte Erfolg. 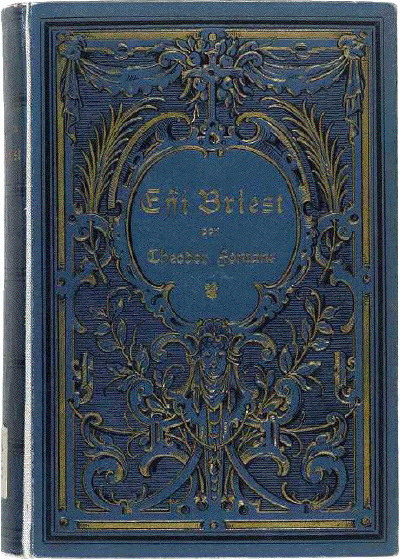 |
|
|
|
Die Erstausgabe des Romans im Verlag von Friedrich Fontane.
|
 Auch in der Presse wurde der Roman ganz überwiegend anerkennend besprochen. "Seit
vier, fünf Wochen gehe ich ganz in Effi-Briest-Angelegenheiten auf", schreibt
Fontane am 19. November 1895 an Georg Friedlaender, "denn wenn ein Mann von
Namen und Ansehn mir eine lange, liebevolle Kritik schickt, so muß ich ihm dafür
danken." Gelobt wurde von den Rezensenten vor allem Darstellerisches, d.h. das
kunstvolle Geflecht der Anspielungen, die Feinheit der Menschenschilderung, der
milde, verständnisvolle Ton, während die Tragik der Handlung, also das minderjährig
verheiratete Mädchen, der Duell-Tod von Crampas, die Folgen der Scheidung und
Effis frühes Sterben nur am Rande interessierten. Und schon gar nicht nahm man die
späterhin oft beschworene 'Gesellschaftskritik' an dem Roman wahr - in
dieser Hinsicht war man durch Zeitungen und Zeitschriften ganz anderes gewöhnt.
In der Berliner Wochenzeitung DIE NATION schreibt Felix Poppenberg am 16. November
1895:
Auch in der Presse wurde der Roman ganz überwiegend anerkennend besprochen. "Seit
vier, fünf Wochen gehe ich ganz in Effi-Briest-Angelegenheiten auf", schreibt
Fontane am 19. November 1895 an Georg Friedlaender, "denn wenn ein Mann von
Namen und Ansehn mir eine lange, liebevolle Kritik schickt, so muß ich ihm dafür
danken." Gelobt wurde von den Rezensenten vor allem Darstellerisches, d.h. das
kunstvolle Geflecht der Anspielungen, die Feinheit der Menschenschilderung, der
milde, verständnisvolle Ton, während die Tragik der Handlung, also das minderjährig
verheiratete Mädchen, der Duell-Tod von Crampas, die Folgen der Scheidung und
Effis frühes Sterben nur am Rande interessierten. Und schon gar nicht nahm man die
späterhin oft beschworene 'Gesellschaftskritik' an dem Roman wahr - in
dieser Hinsicht war man durch Zeitungen und Zeitschriften ganz anderes gewöhnt.
In der Berliner Wochenzeitung DIE NATION schreibt Felix Poppenberg am 16. November
1895: Joseph Victor Widmann schreibt am 17. November 1895 im Berner BUND,
es habe wohl noch kein Roman das "Alles verstehen heißt alles verzeihen"
so überzeugend dargestellt wie dieser:
Joseph Victor Widmann schreibt am 17. November 1895 im Berner BUND,
es habe wohl noch kein Roman das "Alles verstehen heißt alles verzeihen"
so überzeugend dargestellt wie dieser:  Und Otto Pniower urteilt am 22. Februar 1896 in der DEUTSCHEN LITTERATURZEITUNG:
Und Otto Pniower urteilt am 22. Februar 1896 in der DEUTSCHEN LITTERATURZEITUNG:
 Diese Einschätzung verdient umso mehr Beachtung, als Fontane wenige
Jahre früher mit "Irrungen Wirrungen" und "Stine" - bei ganz derselben
Weltsicht - auf weit weniger Verständnis gestoßen war. Die darin
geschilderten 'Verhältnisse' junger Frauen gaben zu Mäkeleien Anlass,
ein Teil der Leserschaft gab zu verstehen, dass er von solchen Unanständigkeiten
verschont bleiben wollte. Effi Briests Ehebruch hingegen störte nicht,
im Gegenteil, alle waren von ihrem Charme, ihrem Liebreiz, ihrer schuldig
gewordenen Unschuld gerührt. An Clara Kühnast, eine Leserin, schreibt
Fontane am 27. Oktober 1895:
Diese Einschätzung verdient umso mehr Beachtung, als Fontane wenige
Jahre früher mit "Irrungen Wirrungen" und "Stine" - bei ganz derselben
Weltsicht - auf weit weniger Verständnis gestoßen war. Die darin
geschilderten 'Verhältnisse' junger Frauen gaben zu Mäkeleien Anlass,
ein Teil der Leserschaft gab zu verstehen, dass er von solchen Unanständigkeiten
verschont bleiben wollte. Effi Briests Ehebruch hingegen störte nicht,
im Gegenteil, alle waren von ihrem Charme, ihrem Liebreiz, ihrer schuldig
gewordenen Unschuld gerührt. An Clara Kühnast, eine Leserin, schreibt
Fontane am 27. Oktober 1895:  Und an Joseph Victor Widmann, den Kritiker vom Berner BUND, schreibt er am 19. November 1895:
Und an Joseph Victor Widmann, den Kritiker vom Berner BUND, schreibt er am 19. November 1895:  Dass Fontane an der geteilten Sympathie des Publikums keineswegs schuldlos war,
wird in der Ebene GESTALTUNG wiederholt nachgewiesen, aber das machte es nicht allein.
An den Äußerungen über Effi zeigt sich, dass man sie auch
als einen Frauen-Typ schätzte, d.h. nicht bloß eine Romanfigur,
sondern eine Art Traumfrau in ihr sah. Wie in einem Aufsatz von 1988 festgestellt,
sprach aus den Sympathie-Bekundungen der Rezensenten oft regelrechte Verliebtheit.
Dass Fontane an der geteilten Sympathie des Publikums keineswegs schuldlos war,
wird in der Ebene GESTALTUNG wiederholt nachgewiesen, aber das machte es nicht allein.
An den Äußerungen über Effi zeigt sich, dass man sie auch
als einen Frauen-Typ schätzte, d.h. nicht bloß eine Romanfigur,
sondern eine Art Traumfrau in ihr sah. Wie in einem Aufsatz von 1988 festgestellt,
sprach aus den Sympathie-Bekundungen der Rezensenten oft regelrechte Verliebtheit. Besonders in den frühen Rezensionen, wo noch in erster Linie der
Lektüreeindruck zur Sprache kommt, gibt sich diese Verliebtheit in aller
Unbefangenheit zu erkennen. Niemand könne Effi seine Anteilnahme versagen,
heißt es da beispielsweise, wenn sie "wie ein im Herbst sterbendes
Vögelchen ihr Erdenleben so bald beschließt". Oder es nennt
Spielhagen sie ein "Blümlein Wunderhold", das - von Fontane "mit allen
seinen zarten Wurzeln" in den Roman verpflanzt - hier für immer seinen
"wonnigen Duft" entfalte. Andere bewundern sie als "große, gewaltige
Persönlichkeit, unverstanden von ihrem Mann und von ihrer ganzen Umgebung",
wohingegen Maximilian Harden eher an ihrer Leichtigkeit Gefallen findet und
sie ironisch-kokett als ein 'flatterlustiges Seelchen' bezeichnet. Entzückt
von dieser 'liebreizenden Figur' ist auch Thomas Mann, und für Heinrich
Mann wird sie später zum Beispiel für die "ganze Schönheit
der großen Menschenschilderung". Auch für Lukács noch
wiederum ist sie Fontanes "liebenswürdigste Gestalt", ein Wesen,
dessen "schlichte Vitalität" und "innere Unverzerrbarkeit"
unvergeßlich seien. Und Beckett läßt seinen Krapp
in "Das letzte Band" davon sprechen, wie er den Roman "wieder einmal
unter Tränen" gelesen und empfunden habe, daß er mit
Effi sicher glücklich geworden wäre.
Besonders in den frühen Rezensionen, wo noch in erster Linie der
Lektüreeindruck zur Sprache kommt, gibt sich diese Verliebtheit in aller
Unbefangenheit zu erkennen. Niemand könne Effi seine Anteilnahme versagen,
heißt es da beispielsweise, wenn sie "wie ein im Herbst sterbendes
Vögelchen ihr Erdenleben so bald beschließt". Oder es nennt
Spielhagen sie ein "Blümlein Wunderhold", das - von Fontane "mit allen
seinen zarten Wurzeln" in den Roman verpflanzt - hier für immer seinen
"wonnigen Duft" entfalte. Andere bewundern sie als "große, gewaltige
Persönlichkeit, unverstanden von ihrem Mann und von ihrer ganzen Umgebung",
wohingegen Maximilian Harden eher an ihrer Leichtigkeit Gefallen findet und
sie ironisch-kokett als ein 'flatterlustiges Seelchen' bezeichnet. Entzückt
von dieser 'liebreizenden Figur' ist auch Thomas Mann, und für Heinrich
Mann wird sie später zum Beispiel für die "ganze Schönheit
der großen Menschenschilderung". Auch für Lukács noch
wiederum ist sie Fontanes "liebenswürdigste Gestalt", ein Wesen,
dessen "schlichte Vitalität" und "innere Unverzerrbarkeit"
unvergeßlich seien. Und Beckett läßt seinen Krapp
in "Das letzte Band" davon sprechen, wie er den Roman "wieder einmal
unter Tränen" gelesen und empfunden habe, daß er mit
Effi sicher glücklich geworden wäre.  Welchem Typus, welchem Idol diese Verliebtheit galt, ist nicht schwer
zu erkennen. Effi ist eine 'Kindfrau', eines dieser jugendlich-erotischen
Geschöpfe, wie es dann auch Lulu oder Lolita sein werden, nur dass Fontane diesen
Typus noch ganz unbefangen, geradezu entzückt, vor sich und sein Publikum
hinstellen kann. In einer Zeit, wo sich die jungen Frauen ihre Ehemänner
mehr und mehr selbst und nach Neigung aussuchten, wo es kaum mehr möglich
war, ein Mädchen aus gutem Hause mit 17 Jahren vor den Traualtar zu führen,
wird Effi einem Mann mal eben von der Schaukel gewinkt und knickst auch
noch dankbar vor dem, der 'eigentlich ihr Vater sein könnte'.
Dass dem Winken dann kein dauerndes Glück folgt, tat der Verliebtheit in
sie keinen Abbruch. Innstetten hatte sie falsch behandelt, hatte dieses
Bonbon nicht verdient - alle konnten sich vorstellen, es an seiner wie
ihrer Stelle besser zu machen.
Welchem Typus, welchem Idol diese Verliebtheit galt, ist nicht schwer
zu erkennen. Effi ist eine 'Kindfrau', eines dieser jugendlich-erotischen
Geschöpfe, wie es dann auch Lulu oder Lolita sein werden, nur dass Fontane diesen
Typus noch ganz unbefangen, geradezu entzückt, vor sich und sein Publikum
hinstellen kann. In einer Zeit, wo sich die jungen Frauen ihre Ehemänner
mehr und mehr selbst und nach Neigung aussuchten, wo es kaum mehr möglich
war, ein Mädchen aus gutem Hause mit 17 Jahren vor den Traualtar zu führen,
wird Effi einem Mann mal eben von der Schaukel gewinkt und knickst auch
noch dankbar vor dem, der 'eigentlich ihr Vater sein könnte'.
Dass dem Winken dann kein dauerndes Glück folgt, tat der Verliebtheit in
sie keinen Abbruch. Innstetten hatte sie falsch behandelt, hatte dieses
Bonbon nicht verdient - alle konnten sich vorstellen, es an seiner wie
ihrer Stelle besser zu machen.  Nur eine der Kritiken nimmt - bei durchaus großem Respekt - zu diesem Roman eine
andere Haltung ein. Es ist die am 14. Dezember 1895 in der Wiener Zeitschrift
DIE ZEIT erschienene Kritik von Franz Servaes, eines Vertreters der Wiener
'Moderne'. Für ihn ist Fontanes Verständnis für alle Beteiligten keine
Stärke, sondern eine Schwäche des Romans, weil damit auch schwere Fehler -
man denke an das Verhalten der Eltern - zugedeckt werden. Er schreibt:
Nur eine der Kritiken nimmt - bei durchaus großem Respekt - zu diesem Roman eine
andere Haltung ein. Es ist die am 14. Dezember 1895 in der Wiener Zeitschrift
DIE ZEIT erschienene Kritik von Franz Servaes, eines Vertreters der Wiener
'Moderne'. Für ihn ist Fontanes Verständnis für alle Beteiligten keine
Stärke, sondern eine Schwäche des Romans, weil damit auch schwere Fehler -
man denke an das Verhalten der Eltern - zugedeckt werden. Er schreibt:  Auch Effi selbst wird von dieser Kritik nicht ausgenommen, auch sie hat
für Servaes etwas Unrichtiges:
Auch Effi selbst wird von dieser Kritik nicht ausgenommen, auch sie hat
für Servaes etwas Unrichtiges:
 Der Schönheit des Romans tut das allerdings auch für Servaes keinen Abbruch, im
Gegenteil, auch ihm ist alles - selbst das Falsche - nur zu überzeugend:
Der Schönheit des Romans tut das allerdings auch für Servaes keinen Abbruch, im
Gegenteil, auch ihm ist alles - selbst das Falsche - nur zu überzeugend: 

 Ein Jahr nach "Effi Briest" erschien überraschend - jedenfalls für Fontane - eine
zweite Bearbeitung des Ardenne-Stoffes, Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib".
Ein Jahr nach "Effi Briest" erschien überraschend - jedenfalls für Fontane - eine
zweite Bearbeitung des Ardenne-Stoffes, Spielhagens Roman "Zum Zeitvertreib".

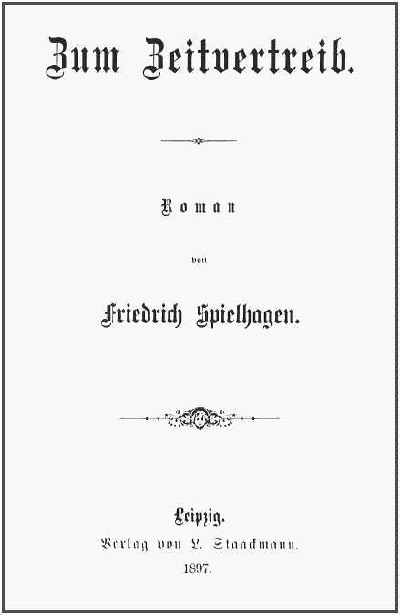 |
|
|
|
Das Titelblatt der Behandlung des Ardenne-Stoffes durch Friedrich Spielhagen.
|
 Dass dies eine Reaktion auf den Roman Fontanes und nicht eigentlich auf den
Ardenne-Fall war, blieb der Öffentlichkeit freilich verborgen, so wie überhaupt die
Identität der Stoffgrundlage kaum wahrgenommen wurde. Friedrich Spielhagen (1829-1911)
kannte die Ardennes aber besser als Fontane. Er hatte in den 70er Jahren mit ihnen
in Berlin in familiärem Umgang gestanden und auch eine Reihe von Briefen mit Elisabeth von
Ardenne gewechselt. So war er über das Duell und seine Folgen
früh unterrichtet. Erst nach dem Erscheinen von "Effi Briest" jedoch hat
er sich zur Aufnahme dieses Stoffes entschlossen. Sein Roman ist mithin eine
Art Antwort auf Fontane, und zwar die Antwort von jemandem, der meinte, es
besser zu wissen. Für die Beurteilung der Ardenne-Geschichte ist dieser
Roman also durchaus von Gewicht, so wenig er sonst für einen Vergleich
infrage kommt. Die Handlung hier ist die folgende:
Dass dies eine Reaktion auf den Roman Fontanes und nicht eigentlich auf den
Ardenne-Fall war, blieb der Öffentlichkeit freilich verborgen, so wie überhaupt die
Identität der Stoffgrundlage kaum wahrgenommen wurde. Friedrich Spielhagen (1829-1911)
kannte die Ardennes aber besser als Fontane. Er hatte in den 70er Jahren mit ihnen
in Berlin in familiärem Umgang gestanden und auch eine Reihe von Briefen mit Elisabeth von
Ardenne gewechselt. So war er über das Duell und seine Folgen
früh unterrichtet. Erst nach dem Erscheinen von "Effi Briest" jedoch hat
er sich zur Aufnahme dieses Stoffes entschlossen. Sein Roman ist mithin eine
Art Antwort auf Fontane, und zwar die Antwort von jemandem, der meinte, es
besser zu wissen. Für die Beurteilung der Ardenne-Geschichte ist dieser
Roman also durchaus von Gewicht, so wenig er sonst für einen Vergleich
infrage kommt. Die Handlung hier ist die folgende: Die schöne, verwöhnte und gelangweilte Klotilde von Sorbitz, Ehefrau eines Berliner Regierungsbeamten und Reserveoffiziers, begegnet auf einer Abendveranstaltung dem Gymnasialprofessor Albrecht Winter, der ihr bereits früher durch seine gewinnende Erscheinung aufgefallen ist. In einem Gespräch entdecken sie ihre gemeinsamen Interessen und fühlen sich rasch zueinander hingezogen.
Bei den Proben zu einer Liebhaberaufführung zweier Winter'scher Stücke sehen sie sich wieder. Winter betet die Frau immer leidenschaftlicher an, und sie fühlt sich geschmeichelt, auch wenn sie sich eines gewissen Standesunterschiedes bewusst bleibt. Bei der Aufführung jedoch gibt sie hinter den Kulissen ihrer Neigung nach und küsst ihn. In der Folge kommt es zu mehreren - als zufällig getarnten - Begegnungen, da beide befürchten, entdeckt zu werden. Auch Winter ist verheiratet, hat drei Kinder und möchte seine ihm treu ergebene Frau nicht verletzen.
Da wird der unsympathische Legationsrat von Fernau auf das Paar aufmerksam, der sich selbst Hoffnungen auf die Zuneigung der schönen Klotilde macht. Er veranlasst Viktor von Sorbitz, seine Frau von einem Detektiv beobachten zu lassen. Winter indessen, um endlich mit Klotilde intim werden zu können, wird unvorsichtig und lädt diese zu einem Abendessen in das Hinterzimmer eines Charlottenburger Lokals ein. Sie kommt auch, ist aber von der anzüglichen Umgebung so ernüchtert, dass sie mit dem Mann nichts mehr zu tun haben will, und auch ihm wird das Unpassende dieses Verhältnisses bewusst. So trennen sie sich, ohne dass es zu einer weiteren Annäherung kommt, und die Affäre scheint beendet.
Doch eben diese letzte Zusammenkunft hat der beauftragte Detektiv beobachtet und meldet sie dem Ehemann. Dieser, seiner Frau schon länger überdrüssig, sieht endlich einen Anlass gegeben, sich ihrer zu entledigen, und fordert Winter zum Zweikampf. Einen Vermittlungsversuch schlägt er aus, und Winter, im Waffengebrauch nicht geübt, fällt. Zurück bleibt als eigentliches Opfer Winters Frau mit ihren drei Kindern. Sie sucht Klotilde von Sorbitz auf und klagt sie an, ihr 'zum Zeitvertreib' den Ehemann und den Kindern den Vater genommen zu haben. Die melodramatisch sich gebärdende Klotilde versteht sich aber selbst als Opfer, da sie ihren Leichtsinn mit der Scheidung zu büßen haben wird.
 Im Bewusstsein seiner Nachfolgerschaft meldet sich Spielhagen bei Fontane erst, als
sein eigener Roman im Vorabdruck in der Zeitschrift "Dies Blatt gehört der Hausfrau"
vorliegt. Am 20. Februar 1896 schreibt er an ihn:
Im Bewusstsein seiner Nachfolgerschaft meldet sich Spielhagen bei Fontane erst, als
sein eigener Roman im Vorabdruck in der Zeitschrift "Dies Blatt gehört der Hausfrau"
vorliegt. Am 20. Februar 1896 schreibt er an ihn:  Die Behauptung Spielhagens, er habe von dem seit über einem Jahr veröffentlichten und
überall erörterten Roman Fontanes erst Kenntnis genommen, nachdem er sein
eigenes Werk abgeschlossen hatte, ist so offensichtlich unwahr, dass man sich über
sie nur wundern kann. Schon eine Woche vor diesem Brief nämlich hatte er Fontane
einen umfangreichen Essay - "'Die Wahlverwandtschaften' und 'Effi Briest'" - zugeschickt,
der klar von seiner schon längeren Beschäftigung mit diesem Roman zeugt. Offenbar
wollte er aber nicht eingestehen, dass er "Zum Zeitvertreib" als eine Art 'Gegenstück'
zu Fontanes Roman konzipiert hatte und damit gewissermaßen in seiner Schuld war. Fontane
antwortete Spielhagen noch am 21. Februar 1896, also postwendend:
Die Behauptung Spielhagens, er habe von dem seit über einem Jahr veröffentlichten und
überall erörterten Roman Fontanes erst Kenntnis genommen, nachdem er sein
eigenes Werk abgeschlossen hatte, ist so offensichtlich unwahr, dass man sich über
sie nur wundern kann. Schon eine Woche vor diesem Brief nämlich hatte er Fontane
einen umfangreichen Essay - "'Die Wahlverwandtschaften' und 'Effi Briest'" - zugeschickt,
der klar von seiner schon längeren Beschäftigung mit diesem Roman zeugt. Offenbar
wollte er aber nicht eingestehen, dass er "Zum Zeitvertreib" als eine Art 'Gegenstück'
zu Fontanes Roman konzipiert hatte und damit gewissermaßen in seiner Schuld war. Fontane
antwortete Spielhagen noch am 21. Februar 1896, also postwendend:  Auch Fontane spielt mit dieser Antwort jedoch nicht mit offenen Karten. Schon
mehrere Tage vorher hatte er nämlich hinsichtlich des ihm übersandten
Spielhagen-Essays an den "Rundschau"-Herausgeber Julius Rodenberg geschrieben,
er wolle sich zu dem Anlass für diesen Essay nur "mal mündlich"
äußern, wusste also über Spielhagens Stoff-Doublette schon Bescheid
und sah dessen Essay als eine Art Wiedergutmachungs-Versuch an. Das war ihm
freilich auch wieder nicht recht, und so hintertrieb er den Abdruck des Essays
in der "Deutschen Rundschau", auf den Spielhagen gesetzt hatte. Aber auch sein
Wissen um den Ardenne-Fall spielt er in dieser Antwort herunter. Dass Frau Lessing
den Namen jener Frau - Ardenne - nicht genau gewusst habe, ist klar die Unwahrheit,
da er die Ardennes ja bei ihr kennen gelernt und deren Geschichte aufgrund seiner
Frage eben von ihr erfahren hatte. (Näheres siehe unter
ENTSTEHUNG) Und auch
mit der vagen Angabe, die Sache habe "am Rhein" gespielt, verdunkelt er den Umfang
seiner Kenntnisse. Offenbar will er für seine Version des Falles lückenhafte
Informiertheit vorschützen und so allen Fragen nach den Gründen für seine
Stoffumgestaltung aus dem Wege gehen. Spielhagen fällt auf die Finte
auch herein und schreibt am 23. Februar 1896, also wiederum
postwendend, zurück:
Auch Fontane spielt mit dieser Antwort jedoch nicht mit offenen Karten. Schon
mehrere Tage vorher hatte er nämlich hinsichtlich des ihm übersandten
Spielhagen-Essays an den "Rundschau"-Herausgeber Julius Rodenberg geschrieben,
er wolle sich zu dem Anlass für diesen Essay nur "mal mündlich"
äußern, wusste also über Spielhagens Stoff-Doublette schon Bescheid
und sah dessen Essay als eine Art Wiedergutmachungs-Versuch an. Das war ihm
freilich auch wieder nicht recht, und so hintertrieb er den Abdruck des Essays
in der "Deutschen Rundschau", auf den Spielhagen gesetzt hatte. Aber auch sein
Wissen um den Ardenne-Fall spielt er in dieser Antwort herunter. Dass Frau Lessing
den Namen jener Frau - Ardenne - nicht genau gewusst habe, ist klar die Unwahrheit,
da er die Ardennes ja bei ihr kennen gelernt und deren Geschichte aufgrund seiner
Frage eben von ihr erfahren hatte. (Näheres siehe unter
ENTSTEHUNG) Und auch
mit der vagen Angabe, die Sache habe "am Rhein" gespielt, verdunkelt er den Umfang
seiner Kenntnisse. Offenbar will er für seine Version des Falles lückenhafte
Informiertheit vorschützen und so allen Fragen nach den Gründen für seine
Stoffumgestaltung aus dem Wege gehen. Spielhagen fällt auf die Finte
auch herein und schreibt am 23. Februar 1896, also wiederum
postwendend, zurück:  Nachdem Fontane den Roman Spielhagens - nunmmehr offiziell - gelesen hat,
schreibt er am 25. August 1896 an diesen:
Nachdem Fontane den Roman Spielhagens - nunmmehr offiziell - gelesen hat,
schreibt er am 25. August 1896 an diesen:  Merkwürdig an dieser Antwort ist nicht nur, dass Fontane Spielhagens Kritik
am Adel hinsichtlich dieses Falles für nicht scharf genug
hält (denn wie scharf war seine?!), sondern auch und erst recht, dass er
nicht ein einziges Wort über den völlig anderen Handlungsablauf verliert.
Wenn er der Meinung gewesen wäre, er habe die wahre Geschichte dieses
Falles erzählt, hätte er aus allen Wolken fallen müssen über den
Abgrund von Schäbigkeit, der sich neben seiner Effi auftat. Doch nichts
dergleichen passiert, der Unterschied kümmert ihn gar nicht, d.h. er wusste nur zu gut, dass
die tatsächliche Geschichte eine andere war und er sich eben
sein Bild
von ihr gemacht hatte. Schon am 13. November 1895 hatte er an eine Leserin - Marie Uhse -
auch geschrieben:
Merkwürdig an dieser Antwort ist nicht nur, dass Fontane Spielhagens Kritik
am Adel hinsichtlich dieses Falles für nicht scharf genug
hält (denn wie scharf war seine?!), sondern auch und erst recht, dass er
nicht ein einziges Wort über den völlig anderen Handlungsablauf verliert.
Wenn er der Meinung gewesen wäre, er habe die wahre Geschichte dieses
Falles erzählt, hätte er aus allen Wolken fallen müssen über den
Abgrund von Schäbigkeit, der sich neben seiner Effi auftat. Doch nichts
dergleichen passiert, der Unterschied kümmert ihn gar nicht, d.h. er wusste nur zu gut, dass
die tatsächliche Geschichte eine andere war und er sich eben
sein Bild
von ihr gemacht hatte. Schon am 13. November 1895 hatte er an eine Leserin - Marie Uhse -
auch geschrieben: 
 Nach Fontanes Tod nahm sein Ansehen und damit auch die Verbreitung seines Werkes
rasch zu. Als "heimlicher Kaiser der deutschen Realisten", wie ihn die
KÖLNISCHE ZEITUNG schon 1898 in einem Nachruf genannt hatte, rückte er innerhalb
weniger Jahrzehnte zum Repräsentanten dieser ganzen literarischen Epoche auf.
Straßen wurden nach ihm benannt, Denkmäler für ihn errichtet - das
erste 1907 in seiner Geburtsstadt Neu-Ruppin -, und durch die große Zahl
der nunmehr veröffentlichten Briefe kam auch der Mensch Fontane immer mehr
Lesern nahe.
Nach Fontanes Tod nahm sein Ansehen und damit auch die Verbreitung seines Werkes
rasch zu. Als "heimlicher Kaiser der deutschen Realisten", wie ihn die
KÖLNISCHE ZEITUNG schon 1898 in einem Nachruf genannt hatte, rückte er innerhalb
weniger Jahrzehnte zum Repräsentanten dieser ganzen literarischen Epoche auf.
Straßen wurden nach ihm benannt, Denkmäler für ihn errichtet - das
erste 1907 in seiner Geburtsstadt Neu-Ruppin -, und durch die große Zahl
der nunmehr veröffentlichten Briefe kam auch der Mensch Fontane immer mehr
Lesern nahe. 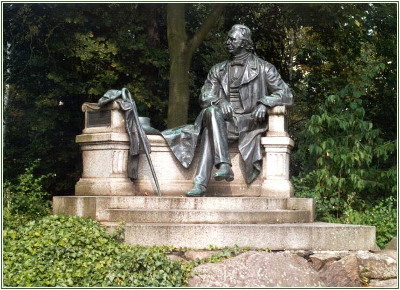 |
|
Das 1907 errichtete Fontane-Denkmal in Neu-Ruppin.
|
 Unter den Romanen, die sich zunehmend mit seinem Namen verbanden, war immer auch
"Effi Briest", stand hier allerdings zunächst nicht an der Spitze. Bis zum Ablauf
des Urheberrechtsschutzes im Jahre 1928 - erst 1934 verlängerte sich die
Schutzfrist auf 50 Jahre über den Tod des Autors hinaus - erreichte "Irrungen
Wirrungen" eine Auflage von 150.000, "Frau Jenny Treibel" 140.000, "L'Adultera"
130.000 und "Effi Briest" 95.000.
Unter den Romanen, die sich zunehmend mit seinem Namen verbanden, war immer auch
"Effi Briest", stand hier allerdings zunächst nicht an der Spitze. Bis zum Ablauf
des Urheberrechtsschutzes im Jahre 1928 - erst 1934 verlängerte sich die
Schutzfrist auf 50 Jahre über den Tod des Autors hinaus - erreichte "Irrungen
Wirrungen" eine Auflage von 150.000, "Frau Jenny Treibel" 140.000, "L'Adultera"
130.000 und "Effi Briest" 95.000.  Herausgehoben wurde der Roman dann aber durch eine erste umfassende Illustrierung,
die im Auftrag der Maximilian-Gesellschaft Max Liebermann (1847-1935) vornahm und
die 1926/27 als Jahresgabe dieser Gesellschaft erschien. An etlichen der Zeichnungen
sieht man allerdings, dass es sich wirklich um eine Auftragsarbeit handelte. Nicht
nur hat Liebermann Entwürfe von anderen seiner Bilder verwendet, er hat auch
die einzelnen Szenen nicht immer romangetreu erfasst. Einem Künstler wie ihm,
der Fontane auch noch selbst gekannt und portätiert hatte, sah man dies jedoch nach -
bis heute werden seine Effi-Briest-Zeichnungen in der INSEL-Ausgabe dieses Romans wiedergegeben.
Herausgehoben wurde der Roman dann aber durch eine erste umfassende Illustrierung,
die im Auftrag der Maximilian-Gesellschaft Max Liebermann (1847-1935) vornahm und
die 1926/27 als Jahresgabe dieser Gesellschaft erschien. An etlichen der Zeichnungen
sieht man allerdings, dass es sich wirklich um eine Auftragsarbeit handelte. Nicht
nur hat Liebermann Entwürfe von anderen seiner Bilder verwendet, er hat auch
die einzelnen Szenen nicht immer romangetreu erfasst. Einem Künstler wie ihm,
der Fontane auch noch selbst gekannt und portätiert hatte, sah man dies jedoch nach -
bis heute werden seine Effi-Briest-Zeichnungen in der INSEL-Ausgabe dieses Romans wiedergegeben.
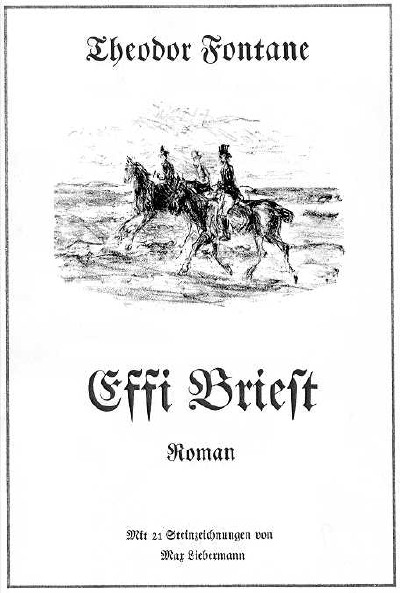 |
|
Das Titelblatt der 1927 von der Maximilian-Gesellschaft herausgebrachten
Ausgabe (hier die Abbildungen).
|
 Mit dem Freiwerden der Rechte setzte sich "Effi Briest" in der Zahl der Nachdrucke
sofort an die Spitze des Fontane'schen Werkes. 1929 erschienen zehn neue deutsche
Ausgaben des Romans, darunter als Nummer 6961 die in Reclams Universal-Bibliothek,
die zugleich der erste Fonntane-Titel bei Reclam überhaupt war. So hat schon in den 30er
Jahren die Gesamtauflage von "Effi Briest" die der anderen Romane Fontanes
übertroffen, und seither hat sich der Abstand nur immer vergrößert.
Mit dem Freiwerden der Rechte setzte sich "Effi Briest" in der Zahl der Nachdrucke
sofort an die Spitze des Fontane'schen Werkes. 1929 erschienen zehn neue deutsche
Ausgaben des Romans, darunter als Nummer 6961 die in Reclams Universal-Bibliothek,
die zugleich der erste Fonntane-Titel bei Reclam überhaupt war. So hat schon in den 30er
Jahren die Gesamtauflage von "Effi Briest" die der anderen Romane Fontanes
übertroffen, und seither hat sich der Abstand nur immer vergrößert.  Den entscheidenden Popularitäts-Schub erhielt "Effi Briest" jedoch durch die Verfilmung
durch Gustav Gründgens (1899-1963) im Jahre 1938 unter dem Titel "Der Schritt vom Wege".
Mit dem UFA-Star Marianne Hoppe in der Rolle der Effi - sie war auch Gründgens' Frau -
erlangte der Film die denkbar größte Popularität und zog natürlich auch
den Roman dabei mit.
Den entscheidenden Popularitäts-Schub erhielt "Effi Briest" jedoch durch die Verfilmung
durch Gustav Gründgens (1899-1963) im Jahre 1938 unter dem Titel "Der Schritt vom Wege".
Mit dem UFA-Star Marianne Hoppe in der Rolle der Effi - sie war auch Gründgens' Frau -
erlangte der Film die denkbar größte Popularität und zog natürlich auch
den Roman dabei mit. 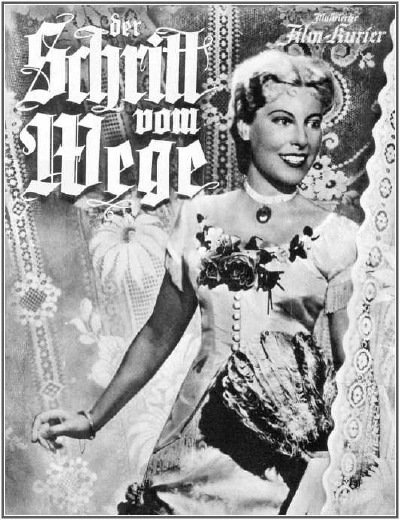 |
|
Das Programmheft der ersten Verfilmung mit Marianne Hoppe (1909-2002).
|
|
Aus dem Programmheft der ersten Verfilmung.
|
 Der Film folgt der Handlung des Romans im Ganzen recht genau, wenn er auch verschiedentlich
Personen und Szenen bündelt. So gehören Roswitha und Rollo hier schon zu Effis
Elternhaus, ist Gieshübler nicht nur Apotheker, sondern auch Effis Arzt, simuliert Effi
ihre Krankheit noch in Kessin (um sich mit Crampas nicht mehr treffen zu müssen) und tritt
die Sängerin Trippelli nicht nur in Kessin auf, sondern auch noch wieder in Bad Ems.
Ebenso werden der Silvesterball und die Theateraufführung in einer Situation zusammengefasst,
wobei hier Kleists "Kätchen von Heilbronn" gespielt wird mit Effi als Käthchen und Crampas
als Ritter vom Strahl. Die auf diese Weise vorbereitete Annäherung der beiden findet auf der
Heimfahrt von dieser Aufführung, als sie gemeinsam den steckengebliebenen Schlitten anschieben
müssen und dann im Dunkeln ein Stück zurückbleiben, ihre Bestätigung in einem ersten Kuss.
Der Film folgt der Handlung des Romans im Ganzen recht genau, wenn er auch verschiedentlich
Personen und Szenen bündelt. So gehören Roswitha und Rollo hier schon zu Effis
Elternhaus, ist Gieshübler nicht nur Apotheker, sondern auch Effis Arzt, simuliert Effi
ihre Krankheit noch in Kessin (um sich mit Crampas nicht mehr treffen zu müssen) und tritt
die Sängerin Trippelli nicht nur in Kessin auf, sondern auch noch wieder in Bad Ems.
Ebenso werden der Silvesterball und die Theateraufführung in einer Situation zusammengefasst,
wobei hier Kleists "Kätchen von Heilbronn" gespielt wird mit Effi als Käthchen und Crampas
als Ritter vom Strahl. Die auf diese Weise vorbereitete Annäherung der beiden findet auf der
Heimfahrt von dieser Aufführung, als sie gemeinsam den steckengebliebenen Schlitten anschieben
müssen und dann im Dunkeln ein Stück zurückbleiben, ihre Bestätigung in einem ersten Kuss.  Erklärt wird Effis 'Schritt vom Wege' hier ganz aus ihrer Langeweile. Marianne Hoppe spielt ein
unkompliziertes, lebensfrohes Geschöpf, das an der Nüchternheit und Strenge ihres
Gatten leidet und sich deshalb der Werbung des draufgängerischen Crampas gern überlässt.
Der Ehebruch selbst wird - wie in dem Roman - nur angedeutet, bleibt aber nicht im Ungewissen und ist
aus den Umständen heraus auch gut nachzuvollziehen. Das Duell wird gar nicht gezeigt, auf das
Auffinden der Briefe und das Gespräch mit Wüllersdorf folgt gleich das Eintreffen der
Nachricht davon in Bad Ems. Wirkt Effi in diesem Moment noch vergleichsweise gefasst, zeigt
sie sich oder zeigt der Film sie in den weiteren Szenen - der Isolation, dem enttäuschenden
Besuch der Tochter, der Heimkehr ins Elternhaus - mehr und mehr sentimental. Mit melodramatischer
Stimme muss sie die Welt- und Lebensweisheiten der letzten Kapitel im Munde führen, ohne dass
man dieser selbstbewussten und patenten jungen Frau ihren Lebensverzicht deshalb glaubt. Mit einem
wirklichen Menschen vor Augen erscheint diese Wendung in Effis Lebenshaltung weit weniger
selbstverständlich als in der sie einfach behauptenden Rede des Romans. Der Film, das
Bild, so kann man verallgemeinernd sagen, lässt uns einen Menschen eben viel vollständiger
wahrnehmen als ein Text, und so fallen hier Dinge als inkonsequent ins Auge, die in der
Wahrnehmungslenkung durch einen Erzähler in ihrer Folgerichtigkeit kaum in Frage stehen.
Erklärt wird Effis 'Schritt vom Wege' hier ganz aus ihrer Langeweile. Marianne Hoppe spielt ein
unkompliziertes, lebensfrohes Geschöpf, das an der Nüchternheit und Strenge ihres
Gatten leidet und sich deshalb der Werbung des draufgängerischen Crampas gern überlässt.
Der Ehebruch selbst wird - wie in dem Roman - nur angedeutet, bleibt aber nicht im Ungewissen und ist
aus den Umständen heraus auch gut nachzuvollziehen. Das Duell wird gar nicht gezeigt, auf das
Auffinden der Briefe und das Gespräch mit Wüllersdorf folgt gleich das Eintreffen der
Nachricht davon in Bad Ems. Wirkt Effi in diesem Moment noch vergleichsweise gefasst, zeigt
sie sich oder zeigt der Film sie in den weiteren Szenen - der Isolation, dem enttäuschenden
Besuch der Tochter, der Heimkehr ins Elternhaus - mehr und mehr sentimental. Mit melodramatischer
Stimme muss sie die Welt- und Lebensweisheiten der letzten Kapitel im Munde führen, ohne dass
man dieser selbstbewussten und patenten jungen Frau ihren Lebensverzicht deshalb glaubt. Mit einem
wirklichen Menschen vor Augen erscheint diese Wendung in Effis Lebenshaltung weit weniger
selbstverständlich als in der sie einfach behauptenden Rede des Romans. Der Film, das
Bild, so kann man verallgemeinernd sagen, lässt uns einen Menschen eben viel vollständiger
wahrnehmen als ein Text, und so fallen hier Dinge als inkonsequent ins Auge, die in der
Wahrnehmungslenkung durch einen Erzähler in ihrer Folgerichtigkeit kaum in Frage stehen.  Der Form nach ist dieser Film, wie in der Frühzeit dieses Mediums die Regel, noch
weitgehend die Wiedergabe eines Theaterstücks. Die Dialoge, überdies oft dem
Roman entnommen, also wohlformulierte Schiftsprache, werden stets wie vor Publikum
gesprochen, der Eindruck der Bühnen-Handlung drängt sich immer wieder auf.
Gleichwohl ist Fontanes Roman darin nicht schlecht getroffen, und die - abgesehen von dem
Schluss - ganz mit sich übereinstimmende Marianne Hoppe als Effi tut ein Übriges,
den Film noch immer sehenswert zu machen.
Der Form nach ist dieser Film, wie in der Frühzeit dieses Mediums die Regel, noch
weitgehend die Wiedergabe eines Theaterstücks. Die Dialoge, überdies oft dem
Roman entnommen, also wohlformulierte Schiftsprache, werden stets wie vor Publikum
gesprochen, der Eindruck der Bühnen-Handlung drängt sich immer wieder auf.
Gleichwohl ist Fontanes Roman darin nicht schlecht getroffen, und die - abgesehen von dem
Schluss - ganz mit sich übereinstimmende Marianne Hoppe als Effi tut ein Übriges,
den Film noch immer sehenswert zu machen. 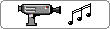
 Sehr kennzeichnend für den Charakter Effis ist der in dieser Szene
als letztes von ihr gesprochene Satz (der bei Fontane nicht vorkommt): "Aber Mama, ich kenne
ihn doch noch gar nicht richtig ..." Darin klingt ebenso Erstaunen über die Amoralität
ihrer Mutter (oder der Erwachsenen) an wie ein Moment neugieriger Hoffnung. Es ist,
als wollte sie sagen: "Ja, wenn das so ist, dass man sich einfach so verheiraten kann,
dann ist das ja vielleicht gar nicht so bedeutsam, dann kann man das auf sich zukommen
lassen, dann muss das gar nicht das Ende aller Überraschungen sein". Und eben so, amüsiert,
neugierig und ohne besondere Skrupel, lässt sie sich dann auch auf die Affäre mit Crampas ein.
Sehr kennzeichnend für den Charakter Effis ist der in dieser Szene
als letztes von ihr gesprochene Satz (der bei Fontane nicht vorkommt): "Aber Mama, ich kenne
ihn doch noch gar nicht richtig ..." Darin klingt ebenso Erstaunen über die Amoralität
ihrer Mutter (oder der Erwachsenen) an wie ein Moment neugieriger Hoffnung. Es ist,
als wollte sie sagen: "Ja, wenn das so ist, dass man sich einfach so verheiraten kann,
dann ist das ja vielleicht gar nicht so bedeutsam, dann kann man das auf sich zukommen
lassen, dann muss das gar nicht das Ende aller Überraschungen sein". Und eben so, amüsiert,
neugierig und ohne besondere Skrupel, lässt sie sich dann auch auf die Affäre mit Crampas ein. Von dem Erfolg des Filmes geleitet, brachte der Walter-Verlag (Wien und Leipzig) 1942
eine "Effi-Briest"-Ausgabe mit 32 Filmbildern heraus (hier die Abbildungen)
und zwei Jahre später folgte ihr
eine weitere illustrierte Ausgabe im Leipziger Verlag "Buch und Volk" mit Zeichnungen
von Kurt Heiligenstaedt (1890-1964). Diese auf schlechtem Papier gedruckte Ausgabe erfuhr
- im letzten Kriegsjahr - allerdings keine weite Verbreitung mehr und die Druckplatten
gingen offenbar durch die Bombardierung verloren. Die kantigen Zeichnungen sind typisch
für den Illustrations-Stil der 30er Jahre und haben mit dem Effi-Briest-Milieu ähnlich
wenig zu tun wie die Zeichnungen Max Liebermanns.
Von dem Erfolg des Filmes geleitet, brachte der Walter-Verlag (Wien und Leipzig) 1942
eine "Effi-Briest"-Ausgabe mit 32 Filmbildern heraus (hier die Abbildungen)
und zwei Jahre später folgte ihr
eine weitere illustrierte Ausgabe im Leipziger Verlag "Buch und Volk" mit Zeichnungen
von Kurt Heiligenstaedt (1890-1964). Diese auf schlechtem Papier gedruckte Ausgabe erfuhr
- im letzten Kriegsjahr - allerdings keine weite Verbreitung mehr und die Druckplatten
gingen offenbar durch die Bombardierung verloren. Die kantigen Zeichnungen sind typisch
für den Illustrations-Stil der 30er Jahre und haben mit dem Effi-Briest-Milieu ähnlich
wenig zu tun wie die Zeichnungen Max Liebermanns. 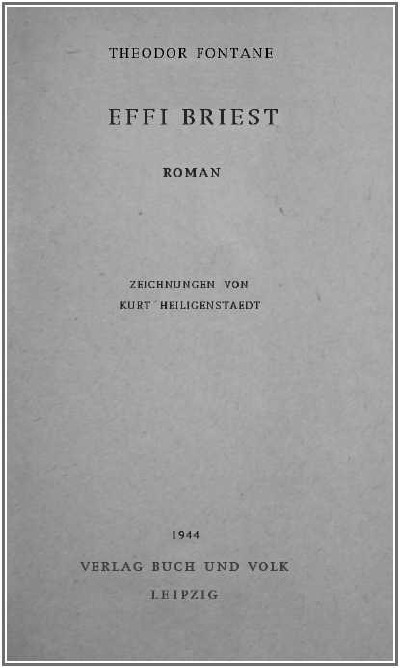 |
|
Das Titelblatt der 1944 in Leipzig erschienenen Ausgabe (hier die Abbildungen).
|
 Eine dritte illustrierte Ausgabe kam 1948 bei Bertelsmann in Gütersloh heraus,
mit 62 Zeichnungen von Gerhard Ulrich (1903-??). Der viel beschäftigte Illustrator
wird den Romanszenen zwar im Ganzen gerecht, zeigt sich aber in seinem Stil
uneinheitlich und wenig markant, und auch eine gewisse humoristische Verniedlichung
ist zu bemerken.
Eine dritte illustrierte Ausgabe kam 1948 bei Bertelsmann in Gütersloh heraus,
mit 62 Zeichnungen von Gerhard Ulrich (1903-??). Der viel beschäftigte Illustrator
wird den Romanszenen zwar im Ganzen gerecht, zeigt sich aber in seinem Stil
uneinheitlich und wenig markant, und auch eine gewisse humoristische Verniedlichung
ist zu bemerken. 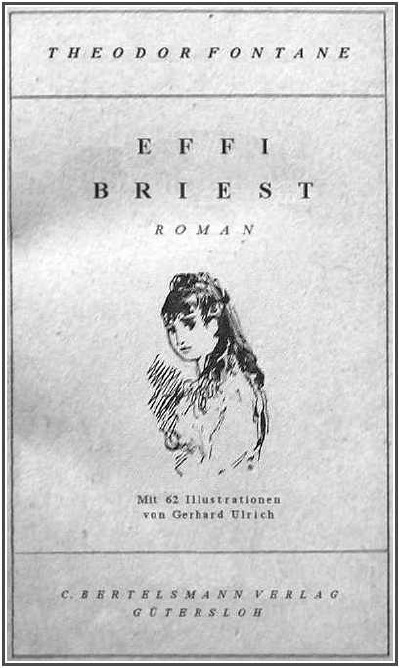 |
|
Das Titelblatt der 1948 bei Bertelsmann erschienenen Ausgabe (hier die Abbildungen).
|
 Eine weitere illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1970 in Genf mit - allerdings nur drei - Linolschnitten von Eduard Prüssen.
Eine weitere illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1970 in Genf mit - allerdings nur drei - Linolschnitten von Eduard Prüssen. 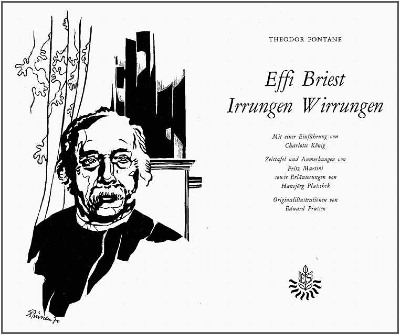 |
|
Die Titelseite der von Eduard Prüssen illustrierten Ausgabe (hier die Abbildungen).
|
 Die bislang letzte illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1972 in Berlin (Ost) im Verlag Neues Leben mit Zeichnungen von Dagmar Elsner-Schwintowsky.
Hier hat ersichtlich der eigene Stil der Illustratorin den Abbildungszweck in den Hintergrund treten lassen, denn von der Atmosphäre des Romans ist in
diesen Zeichnungen wenig wiederzufinden.
Die bislang letzte illustrierte Ausgabe des Romans erschien 1972 in Berlin (Ost) im Verlag Neues Leben mit Zeichnungen von Dagmar Elsner-Schwintowsky.
Hier hat ersichtlich der eigene Stil der Illustratorin den Abbildungszweck in den Hintergrund treten lassen, denn von der Atmosphäre des Romans ist in
diesen Zeichnungen wenig wiederzufinden. 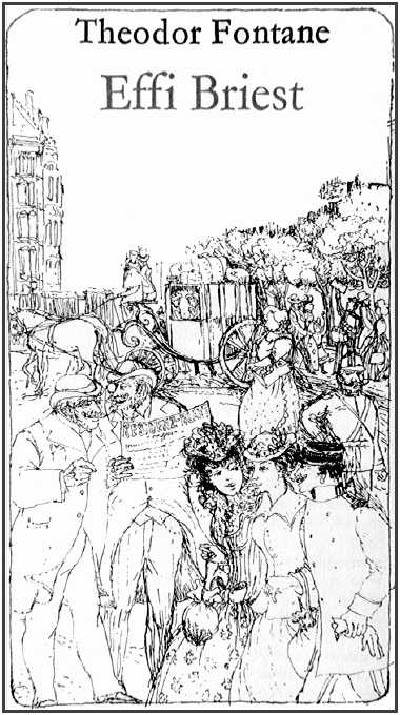 |
|
Die Titelseite der von Dagmar Elsner-Schwintowsky illustrierten Ausgabe (hier die Abbildungen).
|
 Zu einer zweiten Verfilmung kam es 1955 durch die Bavaria-Filmgesellschaft - Regie: Rudolf Jugert (1907-1979) -
unter dem rätselhaften Titel "Rosen im Herbst" nach einem Drehbuch von Horst Budjuhn.
Zu einer zweiten Verfilmung kam es 1955 durch die Bavaria-Filmgesellschaft - Regie: Rudolf Jugert (1907-1979) -
unter dem rätselhaften Titel "Rosen im Herbst" nach einem Drehbuch von Horst Budjuhn. 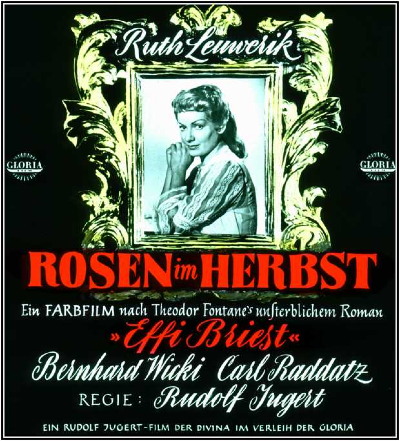 |
|
Das Plakat zur Verfilmung von 1955: die 29-jährige Ruth Leuwerik als Effi
(hier die weiteren Abbildungen). |
 Dieser Film weicht von Fontanes Roman am stärksten ab, nicht nur bloß in der
Handlung, sondern auch schon in der Anlage der Figuren. Bernhard Wicki als Innstetten ist nur sieben Jahre älter als die absolut damenhaft
wirkende Ruth Leuwerik, und so fällt der Eindruck eines Altersabstandes hier nahezu weg. Die Folge: was sich bei Fontane an
Enttäuschungen für Effi aus dem Unterschied der Jahre ergibt, ergibt sich hier aus dem Unterschied der Charaktere.
Innstetten ist ein gefühlsarmer, rücksichtsloser Karrierist, der seine Frau schon fast vorsätzlich in die Arme von Crampas
treibt. Obwohl sie ihn fühlen lässt, dass sie sich vor dem eleganten Kavalier fürchtet,
zwingt er sie mit ihm zu tanzen und trägt sie bei der Situation am Schloon
sogar selbst zu Crampas in die Kutsche, damit dieser sie begleitet. Im Grunde interessiert ihn seine Frau nicht, er
nimmt sie gar nicht wahr, und so ist es mehr Trotz als Neigung, dass sie sich mit Crampas auch einlässt. Doch auch dann
noch bleibt sie die brave, gutwillige Gattin, die sich nur selbst Vorwürfe wegen ihres Verhaltens macht. So enden die heimlichen
Treffen mit Crampas, die hier im Unterschied zu den anderen Verfilmungen sogar in Szene gesetzt werden, in
peinlich melodramatischen Selbstanklagen. Es ist wirklich der reine Kitsch, der bei dieser Umsetzung heraus kommt.
Dieser Film weicht von Fontanes Roman am stärksten ab, nicht nur bloß in der
Handlung, sondern auch schon in der Anlage der Figuren. Bernhard Wicki als Innstetten ist nur sieben Jahre älter als die absolut damenhaft
wirkende Ruth Leuwerik, und so fällt der Eindruck eines Altersabstandes hier nahezu weg. Die Folge: was sich bei Fontane an
Enttäuschungen für Effi aus dem Unterschied der Jahre ergibt, ergibt sich hier aus dem Unterschied der Charaktere.
Innstetten ist ein gefühlsarmer, rücksichtsloser Karrierist, der seine Frau schon fast vorsätzlich in die Arme von Crampas
treibt. Obwohl sie ihn fühlen lässt, dass sie sich vor dem eleganten Kavalier fürchtet,
zwingt er sie mit ihm zu tanzen und trägt sie bei der Situation am Schloon
sogar selbst zu Crampas in die Kutsche, damit dieser sie begleitet. Im Grunde interessiert ihn seine Frau nicht, er
nimmt sie gar nicht wahr, und so ist es mehr Trotz als Neigung, dass sie sich mit Crampas auch einlässt. Doch auch dann
noch bleibt sie die brave, gutwillige Gattin, die sich nur selbst Vorwürfe wegen ihres Verhaltens macht. So enden die heimlichen
Treffen mit Crampas, die hier im Unterschied zu den anderen Verfilmungen sogar in Szene gesetzt werden, in
peinlich melodramatischen Selbstanklagen. Es ist wirklich der reine Kitsch, der bei dieser Umsetzung heraus kommt.
 Aber auch in die Handlung greift der Film massiv ein. Die Übersiedlung der Innstettens nach Berlin fällt hier in
das Jahr 1900, wird also um 20 Jahre versetzt. Ebenso wird die Auffindung der Briefe anders begründet: Anni sucht
im Nähkasten der Mutter nach einer Schleife und kramt dabei die Briefe heraus, die also noch nicht einmal unter
Verschluss sind. Gut getroffen sind hingegen einige Nebenfiguren: Effis Eltern, die Trippelli und ganz besonders Gieshübler,
der mit Günther Lüders die ideale Apotheker-Figur abgibt. Im Ganzen hat diese Verfilmung aber mehr mit
der realen Ardenne-Geschichte als mit "Effi Briest" zu tun, auch wenn zum Zeitpunkt der Verfilmung über diese noch gar
nichts bekannt war.
Aber auch in die Handlung greift der Film massiv ein. Die Übersiedlung der Innstettens nach Berlin fällt hier in
das Jahr 1900, wird also um 20 Jahre versetzt. Ebenso wird die Auffindung der Briefe anders begründet: Anni sucht
im Nähkasten der Mutter nach einer Schleife und kramt dabei die Briefe heraus, die also noch nicht einmal unter
Verschluss sind. Gut getroffen sind hingegen einige Nebenfiguren: Effis Eltern, die Trippelli und ganz besonders Gieshübler,
der mit Günther Lüders die ideale Apotheker-Figur abgibt. Im Ganzen hat diese Verfilmung aber mehr mit
der realen Ardenne-Geschichte als mit "Effi Briest" zu tun, auch wenn zum Zeitpunkt der Verfilmung über diese noch gar
nichts bekannt war.
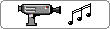
 Charakteristisch ist hier ebenso Effis naive Freude über den Antrag Innstettens -
diese Effi ist ja über das beste Heiratsalter schon fast hinaus - wie die
durchaus souveräne Art, mit der sie auf das unbeholfene Kompliment, sie
reite sehr schnell, reagiert. Sie ist eben keine unsichere Siebzehnjährige, sondern
tritt Innstetten ganz gleichberechtigt gegenüber.
Charakteristisch ist hier ebenso Effis naive Freude über den Antrag Innstettens -
diese Effi ist ja über das beste Heiratsalter schon fast hinaus - wie die
durchaus souveräne Art, mit der sie auf das unbeholfene Kompliment, sie
reite sehr schnell, reagiert. Sie ist eben keine unsichere Siebzehnjährige, sondern
tritt Innstetten ganz gleichberechtigt gegenüber.  Die dritte Verfilmung war die der DEFA im Jahre 1968 unter der Regie von Wolfgang
Luderer (gest. 1995) mit Angelica Domröse in der Titelrolle.
Die dritte Verfilmung war die der DEFA im Jahre 1968 unter der Regie von Wolfgang
Luderer (gest. 1995) mit Angelica Domröse in der Titelrolle.  |
|
Ein Titelbild der Zeitschrift "Film für Sie": Die 27-jährige Angelica Domröse als Effi
(hier die Abbildungen). |
 Es ist dies die genaueste, werkgetreuste Verfilmung von allen, eine Augenweide
allein schon wegen der Sorgfalt der Ausstattung. Angelica Domröse ist unter den vier Effi-Figuren auch die kindlichste und insoweit in vielen Szenen
glaubwürdiger als die Schauspielerinnen der anderen Filme. Allenfalls das Schüchterne und Furchtsame glaubt man ihr nicht so ganz.
Aber auch Innstetten ist mit Horst Schulze, dem damaligen Star des Dresdner Schauspielhauses, sehr überzeugend besetzt,
ohne jede Verzeichnung ins Herzlose oder gar Böse, wie es in den Filmen von Jugert und Fassbinder der Fall ist.
Die Affäre mit Crampas wird hier weitgehend mit einer vorübergehenden Abwesenheit Innstettens
erklärt, nur aus jugendlichem Leichtsinn lässt sich Effi mit ihm ein. Mit dem
Schluss des Films hat man bei diesem Temperament deshalb aber dieselben Probleme wie
für Marianne Hoppe in der Verfilmung von Gründgens: man glaubt einer solchen
Frau ihren Lebens-Verzicht einfach nicht. Aber in den Bildern und der Stimmung
wird auch hier Fontanes Roman bewundernswert gut getroffen.
Es ist dies die genaueste, werkgetreuste Verfilmung von allen, eine Augenweide
allein schon wegen der Sorgfalt der Ausstattung. Angelica Domröse ist unter den vier Effi-Figuren auch die kindlichste und insoweit in vielen Szenen
glaubwürdiger als die Schauspielerinnen der anderen Filme. Allenfalls das Schüchterne und Furchtsame glaubt man ihr nicht so ganz.
Aber auch Innstetten ist mit Horst Schulze, dem damaligen Star des Dresdner Schauspielhauses, sehr überzeugend besetzt,
ohne jede Verzeichnung ins Herzlose oder gar Böse, wie es in den Filmen von Jugert und Fassbinder der Fall ist.
Die Affäre mit Crampas wird hier weitgehend mit einer vorübergehenden Abwesenheit Innstettens
erklärt, nur aus jugendlichem Leichtsinn lässt sich Effi mit ihm ein. Mit dem
Schluss des Films hat man bei diesem Temperament deshalb aber dieselben Probleme wie
für Marianne Hoppe in der Verfilmung von Gründgens: man glaubt einer solchen
Frau ihren Lebens-Verzicht einfach nicht. Aber in den Bildern und der Stimmung
wird auch hier Fontanes Roman bewundernswert gut getroffen.  Problematisch an dieser Verfilmung ist allein ihre Fülle. In dem Bemühen, möglichst
viele Szenen werkgetreu ins Bild zu setzen, bekommt der Film, wie richtig bemerkt
worden ist, "etwas Bilderbogenhaftes". Die Einheitlichkeit des Tons, mit der ein
Roman eine solche Vielfalt zusammenhält, ist bei einer Szenenfolge, wo jede Szene für
sich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht leicht herzustellen, und in diesem Fall hat der
Leitgedanke der Werktreue einfach zu viele verschiedenartige Szenen nach sich gezogen.
Problematisch an dieser Verfilmung ist allein ihre Fülle. In dem Bemühen, möglichst
viele Szenen werkgetreu ins Bild zu setzen, bekommt der Film, wie richtig bemerkt
worden ist, "etwas Bilderbogenhaftes". Die Einheitlichkeit des Tons, mit der ein
Roman eine solche Vielfalt zusammenhält, ist bei einer Szenenfolge, wo jede Szene für
sich die Aufmerksamkeit auf sich zieht, nicht leicht herzustellen, und in diesem Fall hat der
Leitgedanke der Werktreue einfach zu viele verschiedenartige Szenen nach sich gezogen.
 Dass man dem Film aus westlicher Sicht eine Tendenz zum 'Sozialistischen Realismus'
nachgesagt hat (siehe den nachfolgenden Literaturhinweis zu Fassbinders Effi-Briest-Verfilmung),
bezeugt jedoch nur die damals im Westen verbreitete blamable Unkenntnis der DDR-Verhältnisse.
Politisch abstinenter und von andächtigerer Werk-Verehrung als diese "Effi Briest" kann eine
Literatur-Verfilmung nicht sein.
Dass man dem Film aus westlicher Sicht eine Tendenz zum 'Sozialistischen Realismus'
nachgesagt hat (siehe den nachfolgenden Literaturhinweis zu Fassbinders Effi-Briest-Verfilmung),
bezeugt jedoch nur die damals im Westen verbreitete blamable Unkenntnis der DDR-Verhältnisse.
Politisch abstinenter und von andächtigerer Werk-Verehrung als diese "Effi Briest" kann eine
Literatur-Verfilmung nicht sein. 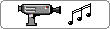
 Sehr schön kommt hier der Altersabstand zwischen Effi und Innstetten zur
Geltung: Innstetten steht beinahe schüchtern vor so viel Jugend.
Sehr schön kommt hier der Altersabstand zwischen Effi und Innstetten zur
Geltung: Innstetten steht beinahe schüchtern vor so viel Jugend.
 Die vierte Verfilmung erfolgte 1974 durch Rainer Werner Fassbinder (1945-1982)
mit Hanna Schygulla in der Titelrolle. Sie wurde von der Presse geradezu enthusiastisch gefeiert
und lief in den Kinos der Großstädte viele Wochen lang
(hier die Abbildungen).
Die vierte Verfilmung erfolgte 1974 durch Rainer Werner Fassbinder (1945-1982)
mit Hanna Schygulla in der Titelrolle. Sie wurde von der Presse geradezu enthusiastisch gefeiert
und lief in den Kinos der Großstädte viele Wochen lang
(hier die Abbildungen). 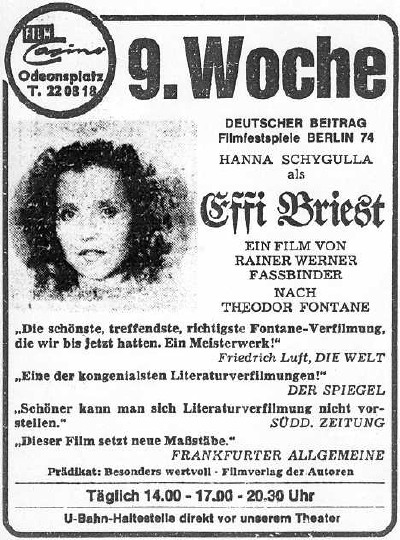 |
|
Eine Anzeige aus der Süddeutschen Zeitung vom August 1974.
|
 Das Ungewöhnliche dieses Werkes liegt zunächst einmal darin, dass es sich um eine
Verfilmung im herkömmlichen Sinne gar nicht handelt. Zu größeren Teilen
wird der Roman nur vorgelesen (diese Partien liest Fassbinder selbst), und in den
Kernszenen wird er von den Schauspielern rezitiert. Man muss dies so sagen, weil
überwiegend nicht gespielt, nicht agiert, sondern der Text nur gespochen wird,
als sei es ein innerer Monolog. Wie wichtig Fassbinder dabei das Stimmliche war,
zeigt sich daran, dass er mehrere der Rollen von Synchron-Sprechern nachsprechen ließ: der
weltabgewandte Ton, den er haben wollte, kam ihm bei den Darstellern selbst nicht gut genug
heraus. Aus dem Unterschied zwischen dem gesprochenem Text und den gezeigten Bildern
ergeben sich allerdings immer wieder ironische Kontraste. Gleich zu Anfang wird der
'helle Sonnenschein der mittagsstillen Dorfstraße' zitiert, doch man sieht eine
verschattete Morgen- oder Abendbeleuchtung. Oder es wird von Effis wilder und
leidenschaftlicher Umarmung der Mutter gesprochen, doch sie steht nur in stiller
Pose neben ihr. Nur zwei der Szenen werden auch 'gespielt': das Gespräch
zwischen Innstetten und Wüllersdorf und Effis Zornesausbruch nach dem
unglücklichen Wiedersehen mit Annie. Hier, wo bestimmte gesellschaftliche
Verhältnisse von den mitwirkenden Personen unmittelbar kritisiert werden, zeigt
auch der Film sie leidenschaftlich, so als seien sie nur in diesen Momenten
bei Bewusstsein und alles andere mehr ein Reden neben ihnen oder über sie.
Das Ungewöhnliche dieses Werkes liegt zunächst einmal darin, dass es sich um eine
Verfilmung im herkömmlichen Sinne gar nicht handelt. Zu größeren Teilen
wird der Roman nur vorgelesen (diese Partien liest Fassbinder selbst), und in den
Kernszenen wird er von den Schauspielern rezitiert. Man muss dies so sagen, weil
überwiegend nicht gespielt, nicht agiert, sondern der Text nur gespochen wird,
als sei es ein innerer Monolog. Wie wichtig Fassbinder dabei das Stimmliche war,
zeigt sich daran, dass er mehrere der Rollen von Synchron-Sprechern nachsprechen ließ: der
weltabgewandte Ton, den er haben wollte, kam ihm bei den Darstellern selbst nicht gut genug
heraus. Aus dem Unterschied zwischen dem gesprochenem Text und den gezeigten Bildern
ergeben sich allerdings immer wieder ironische Kontraste. Gleich zu Anfang wird der
'helle Sonnenschein der mittagsstillen Dorfstraße' zitiert, doch man sieht eine
verschattete Morgen- oder Abendbeleuchtung. Oder es wird von Effis wilder und
leidenschaftlicher Umarmung der Mutter gesprochen, doch sie steht nur in stiller
Pose neben ihr. Nur zwei der Szenen werden auch 'gespielt': das Gespräch
zwischen Innstetten und Wüllersdorf und Effis Zornesausbruch nach dem
unglücklichen Wiedersehen mit Annie. Hier, wo bestimmte gesellschaftliche
Verhältnisse von den mitwirkenden Personen unmittelbar kritisiert werden, zeigt
auch der Film sie leidenschaftlich, so als seien sie nur in diesen Momenten
bei Bewusstsein und alles andere mehr ein Reden neben ihnen oder über sie.
 Der Sinn dieses Verfahrens ist schon durch den Titel des Filmes angezeigt, der
vollständig lautet:
Der Sinn dieses Verfahrens ist schon durch den Titel des Filmes angezeigt, der
vollständig lautet:  Diese im Stil der Verlautbarungen der Studentenbewegung jener Zeit gehaltene
Titulierung sieht Effi ganz als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, in ihrer
Sanftmut aber eben zu keiner Anklage fähig. An einen gefühllosen Grobian
verheiratet, kann sie nur im Verhältnis zu Crampas eine gewisse Erfüllung
finden, obwohl ihr dieser - hier jünger als sie - in keiner Weise gewachsen ist.
Diese im Stil der Verlautbarungen der Studentenbewegung jener Zeit gehaltene
Titulierung sieht Effi ganz als Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, in ihrer
Sanftmut aber eben zu keiner Anklage fähig. An einen gefühllosen Grobian
verheiratet, kann sie nur im Verhältnis zu Crampas eine gewisse Erfüllung
finden, obwohl ihr dieser - hier jünger als sie - in keiner Weise gewachsen ist.
 Störend, weil ohne jede Verbindung zu Fontanes Roman, ist oftmals die Ausstattung.
Innstetten in Kessin wohnt nicht in einer 'Kate', sondern residiert wie in einem
Schloss, das für Effi natürlich der sprichwörtliche 'goldene Käfig'
sein soll. Die Wohnung in Berlin hingegen wirkt wieder zu modern - in diesem Falle
wohl als Anspielung auf Innstettens Karriere zu verstehen. Der einheitlich
elegische Ton, in dem der Film von der ersten bis zur letzten Szene gehalten ist,
ist allerdings auf die Dauer schwer zu ertragen. Wären die kunstvoll
hinzuarrangierten 'lebenden Bilder' nicht, würde man diese 'Lesung' schwerlich
auf einmal durchstehen. Und wiederholt gar wird sich niemand diese das Gemüt
belastende Verfilmung so leicht antun.
Störend, weil ohne jede Verbindung zu Fontanes Roman, ist oftmals die Ausstattung.
Innstetten in Kessin wohnt nicht in einer 'Kate', sondern residiert wie in einem
Schloss, das für Effi natürlich der sprichwörtliche 'goldene Käfig'
sein soll. Die Wohnung in Berlin hingegen wirkt wieder zu modern - in diesem Falle
wohl als Anspielung auf Innstettens Karriere zu verstehen. Der einheitlich
elegische Ton, in dem der Film von der ersten bis zur letzten Szene gehalten ist,
ist allerdings auf die Dauer schwer zu ertragen. Wären die kunstvoll
hinzuarrangierten 'lebenden Bilder' nicht, würde man diese 'Lesung' schwerlich
auf einmal durchstehen. Und wiederholt gar wird sich niemand diese das Gemüt
belastende Verfilmung so leicht antun.  Dennoch trifft Fassbinders Film eine Seite des Romans vielleicht besser als die drei
anderen: das Träumerisch-Unwirkliche der Figur Effis selbst. In Hanna
Schygulla ist sie ein Wesen wie nicht von dieser Welt. Dass sie Innstetten
betrogen hat, wird gar nicht realisiert. Sie ist von Anfang bis Ende das
Menschenkind, das für uns alle zu schade ist - jenes Inbild von Poesie eben,
als das man auch die Romanfigur wahrzunehmen gewohnt ist.
Dennoch trifft Fassbinders Film eine Seite des Romans vielleicht besser als die drei
anderen: das Träumerisch-Unwirkliche der Figur Effis selbst. In Hanna
Schygulla ist sie ein Wesen wie nicht von dieser Welt. Dass sie Innstetten
betrogen hat, wird gar nicht realisiert. Sie ist von Anfang bis Ende das
Menschenkind, das für uns alle zu schade ist - jenes Inbild von Poesie eben,
als das man auch die Romanfigur wahrzunehmen gewohnt ist. 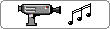
 Die fünfte und vorerst letzte Verfilmung ist die von Hermine Huntgeburth (geb. 1957) mit Julia Jentsch in der Hauptrolle, in die
Kinos gekommen im Februar 2009 (Abbildungen). Sie folgt der Romanhandlung
in der Hauptlinie genau, weicht zuletzt allerdings entschieden von ihr ab: Effi stirbt nicht, sondern sie wird wie ihr Urbild Elisabeth von Ardenne
berufstätig.
Die fünfte und vorerst letzte Verfilmung ist die von Hermine Huntgeburth (geb. 1957) mit Julia Jentsch in der Hauptrolle, in die
Kinos gekommen im Februar 2009 (Abbildungen). Sie folgt der Romanhandlung
in der Hauptlinie genau, weicht zuletzt allerdings entschieden von ihr ab: Effi stirbt nicht, sondern sie wird wie ihr Urbild Elisabeth von Ardenne
berufstätig. Dieser Schluss ist zugleich auch die Botschaft des Filmes. Er zeigt - oder will zeigen -, wie eine von ihren Eltern und ihrem
Ehemann gänzlich unmündig gehaltene junge Frau sich durch eine sexuelle Affäre erst entdeckt und zu einem selbstbestimmten
Leben fähig wird. Das bewährt sich, als sie von Innstetten geschieden und von ihren Eltern verstoßen wird. Sie verzweifelt nicht,
sondern nimmt eine Stelle als Hilfsbibliothekarin an, die ihr - gemeinsam mit Roswitha - anscheinend auch ein auskömmliches Leben sichert.
Dieser Schluss ist zugleich auch die Botschaft des Filmes. Er zeigt - oder will zeigen -, wie eine von ihren Eltern und ihrem
Ehemann gänzlich unmündig gehaltene junge Frau sich durch eine sexuelle Affäre erst entdeckt und zu einem selbstbestimmten
Leben fähig wird. Das bewährt sich, als sie von Innstetten geschieden und von ihren Eltern verstoßen wird. Sie verzweifelt nicht,
sondern nimmt eine Stelle als Hilfsbibliothekarin an, die ihr - gemeinsam mit Roswitha - anscheinend auch ein auskömmliches Leben sichert.
 Von der Gefälligkeit und Versöhnlichkeit des Fontane'schen Romans bleibt dabei allerdings
nichts übrig. Effi ist hier so sprach-, willen- und auch charakterlos, wie es die Romanfigur bei weitem nicht ist und wie man es auch Julia Jentsch als
Erscheinung nicht abnimmt, im Grunde eine 'Frau ohne Eigenschaften', nur Opfer. Innstetten ist ein gemüt- und verständnisloser Bürokrat,
der seine Frau in der Hochzeitsnacht nahezu vergewaltigt - mit dem smarten Sebastian Koch in keiner Weise glaubhaft besetzt. Am besten ist noch der
alte Briest getroffen, der hier aber völlig unter der Vormundschaft seiner Frau steht. Diese hat Effi die Ehe mit Innstetten hauptsächlich
aufgenötigt, weil sie mit ihm, ihrem früheren Verehrer, wieder in näheren Kontakt kommen will. Ein intimer Briefwechsel zwischen den
beiden, hinter Effis Rücken geführt, gibt darüber letzte Gewissheit. So kommt es dazu, dass Effi auch ein Versöhnungsangebot
der Eltern zum Schluss zurückweist. Sie zündet sich in ihrer Gegenwart eine Zigarette an, sagt sich von ihnen los und
geht ihrer Wege - wie eine Vorläuferin der 1968er Protest-Generation.
Von der Gefälligkeit und Versöhnlichkeit des Fontane'schen Romans bleibt dabei allerdings
nichts übrig. Effi ist hier so sprach-, willen- und auch charakterlos, wie es die Romanfigur bei weitem nicht ist und wie man es auch Julia Jentsch als
Erscheinung nicht abnimmt, im Grunde eine 'Frau ohne Eigenschaften', nur Opfer. Innstetten ist ein gemüt- und verständnisloser Bürokrat,
der seine Frau in der Hochzeitsnacht nahezu vergewaltigt - mit dem smarten Sebastian Koch in keiner Weise glaubhaft besetzt. Am besten ist noch der
alte Briest getroffen, der hier aber völlig unter der Vormundschaft seiner Frau steht. Diese hat Effi die Ehe mit Innstetten hauptsächlich
aufgenötigt, weil sie mit ihm, ihrem früheren Verehrer, wieder in näheren Kontakt kommen will. Ein intimer Briefwechsel zwischen den
beiden, hinter Effis Rücken geführt, gibt darüber letzte Gewissheit. So kommt es dazu, dass Effi auch ein Versöhnungsangebot
der Eltern zum Schluss zurückweist. Sie zündet sich in ihrer Gegenwart eine Zigarette an, sagt sich von ihnen los und
geht ihrer Wege - wie eine Vorläuferin der 1968er Protest-Generation.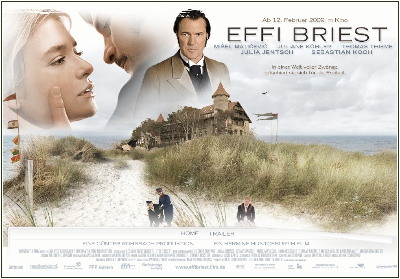 |
|
Das Plakat zur Verfilmung von 2009
|
 Es ist nicht zuletzt auf die Serie der Verfilmungen zurückzuführen, dass
Fontane heute vielen allein als der Verfasser von "Effi Briest" bekannt
ist, und auch in den Schulen wird - wenn überhaupt Fontane - nur dieser
Roman von ihm gelesen. Doch auch nach der Menge der Sekundärliteratur liegt er
innerhalb des Fontaneschen Werkes an der Spitze. Hier wird allerdings nahezu
ausschließlich sein Kunstcharakter untersucht und hervorgehoben, fast als
wollte man gewisse inhaltlichen Schwächen darüber vergessen machen.
Soweit Autoren sich auf den Inhalt jedoch einlassen, kommen sie um den
einen und anderen kritischen Akzent nicht herum - die Sentimentalität des Schlusses
betreffend etwa oder das nicht völlig Nachvollziehbare von Effis Verhältnis zu
Crampas oder überhaupt das nicht ganz Stimmige ihres Persönlichkeitsbildes.
Ihre Bereitschaft, dem ersten standesgemäßen Freier ihr Jawort zu geben, schreibt
Gisela Elsner, passe nicht zu dem 'Wildfang', als der Effi in ihrem Elternhaus
aufwachse, das "nackte Bekenntnis zum Karrierismus", mit dem sie sich an
Innstetten verheiraten lasse, müsste diesem Mädchen eigentlich fremd sein.
Es ist nicht zuletzt auf die Serie der Verfilmungen zurückzuführen, dass
Fontane heute vielen allein als der Verfasser von "Effi Briest" bekannt
ist, und auch in den Schulen wird - wenn überhaupt Fontane - nur dieser
Roman von ihm gelesen. Doch auch nach der Menge der Sekundärliteratur liegt er
innerhalb des Fontaneschen Werkes an der Spitze. Hier wird allerdings nahezu
ausschließlich sein Kunstcharakter untersucht und hervorgehoben, fast als
wollte man gewisse inhaltlichen Schwächen darüber vergessen machen.
Soweit Autoren sich auf den Inhalt jedoch einlassen, kommen sie um den
einen und anderen kritischen Akzent nicht herum - die Sentimentalität des Schlusses
betreffend etwa oder das nicht völlig Nachvollziehbare von Effis Verhältnis zu
Crampas oder überhaupt das nicht ganz Stimmige ihres Persönlichkeitsbildes.
Ihre Bereitschaft, dem ersten standesgemäßen Freier ihr Jawort zu geben, schreibt
Gisela Elsner, passe nicht zu dem 'Wildfang', als der Effi in ihrem Elternhaus
aufwachse, das "nackte Bekenntnis zum Karrierismus", mit dem sie sich an
Innstetten verheiraten lasse, müsste diesem Mädchen eigentlich fremd sein.
 Einen anderen kritischen Akzent setzt Christine Brückner in ihren 'Ungehaltenen
Reden ungehaltener Frauen', einer imaginären Ansprache Effis an ihren Hund Rollo.
Ihren vielbewunderten Jugend-Charme macht Effi sich hier zum Vorwurf und wendet
sich damit gewissermaßen auch gegen den Autor, der in dieser Hinsicht ja ihr
Hauptverehrer ist:
Einen anderen kritischen Akzent setzt Christine Brückner in ihren 'Ungehaltenen
Reden ungehaltener Frauen', einer imaginären Ansprache Effis an ihren Hund Rollo.
Ihren vielbewunderten Jugend-Charme macht Effi sich hier zum Vorwurf und wendet
sich damit gewissermaßen auch gegen den Autor, der in dieser Hinsicht ja ihr
Hauptverehrer ist:
 An Fontane gerichtet, müsste die Frage heißen: Warum fällt nicht ein einziges kritisches
Wort darüber, dass Effi sich um ihr Kind nicht kümmert? Warum lässt er es für sie nahezu
nicht vorhanden sein bis zu dem Tag, wo sie es als längst geschiedene Frau wiedersehen
will? Vielleicht nicht doch nur, damit sie als Liebesobjekt umso begehrenswerter erscheint?
Und zu Effis Eltern bemerkt Christine Brückner in einer Tagebuch-Aufzeichnung (Mein schwarzes
Sofa. Aufzeichnungen. Frankfurt/Berlin 1981. S. 266):
An Fontane gerichtet, müsste die Frage heißen: Warum fällt nicht ein einziges kritisches
Wort darüber, dass Effi sich um ihr Kind nicht kümmert? Warum lässt er es für sie nahezu
nicht vorhanden sein bis zu dem Tag, wo sie es als längst geschiedene Frau wiedersehen
will? Vielleicht nicht doch nur, damit sie als Liebesobjekt umso begehrenswerter erscheint?
Und zu Effis Eltern bemerkt Christine Brückner in einer Tagebuch-Aufzeichnung (Mein schwarzes
Sofa. Aufzeichnungen. Frankfurt/Berlin 1981. S. 266):



 Unter den vielen Ausgaben, in denen "Effi Briest" in jüngerer Zeit erschienen ist,
ragt die im Aufbau-Verlag Berlin erscheinende "Große Brandenburger Ausgabe" von Gotthard
Erler heraus, im Falle des Effi-Briest-Bandes ediert von Christine Hehle. Diese Ausgabe hält
sich strikt an die Textgestalt der Erstdrucke und zeichnet sich durch eine hervorragende
Kommentierung aus. Solange es eine 'kritische' Ausgabe der Werke Fontanes nicht gibt, also
eine, die über Handschrift und Drucke den von ihm ursprünglich gewünschten Wortlaut
restlos erschließt, bietet die "Große Brandenburger Ausgabe" zur Textgestalt die
verlässlichste Auskunft.
Unter den vielen Ausgaben, in denen "Effi Briest" in jüngerer Zeit erschienen ist,
ragt die im Aufbau-Verlag Berlin erscheinende "Große Brandenburger Ausgabe" von Gotthard
Erler heraus, im Falle des Effi-Briest-Bandes ediert von Christine Hehle. Diese Ausgabe hält
sich strikt an die Textgestalt der Erstdrucke und zeichnet sich durch eine hervorragende
Kommentierung aus. Solange es eine 'kritische' Ausgabe der Werke Fontanes nicht gibt, also
eine, die über Handschrift und Drucke den von ihm ursprünglich gewünschten Wortlaut
restlos erschließt, bietet die "Große Brandenburger Ausgabe" zur Textgestalt die
verlässlichste Auskunft. 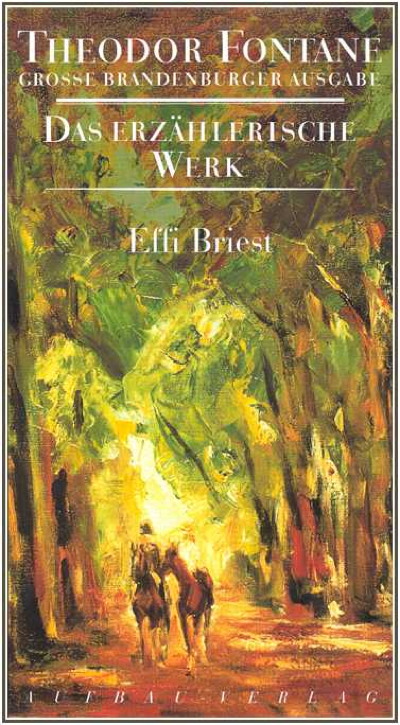 |
|
Die Umschlagseite von "Effi Briest" in der Großen Brandenburger Ausgabe, 1998 herausgegeben und kommentiert von Christine Hehle.
|
 Der 1995 erschienene Roman "Ein weites Feld" von Günter Grass zitiert
zwar in seinem Titel die bekannte Redewendung aus "Effi Briest" und nimmt auch
auf Fontane Bezug, hat aber mit der Effi-Briest-Geschichte nichts zu tun. Seine
Hauptgestalt ist der Fontane-Liebhaber Theo Wuttke (Fonty genannt), der sich unter
den Werken Fontanes vor allem für den Roman "Irrungen Wirrungen" interessiert und
für ihn einen bestimmten Erlebnis-Hintergrund erschließt bzw. 'erforscht'. Die beiden -
vermeintlich in Dresden - von Fontane gezeugten unehelichen Kinder
sollen demnach Kinder einer Gärtnerstochter gewesen sein, die Fontane sitzen
ließ und die dann als Lene Nimptsch in seinem Werk wiederkehrt. Wuttke alias Fonty
scheint oder wünscht, Urenkel eines dieser Kinder zu sein und damit in
direkter Linie von Fontane selbst abzustammen. Wahr ist an dieser Geschichte
freilich nichts, auch wenn Grass die Fontane-Forschung damit zunächst verblüffen
konnte, sie ist nicht einmal plausibel erfunden.
Der 1995 erschienene Roman "Ein weites Feld" von Günter Grass zitiert
zwar in seinem Titel die bekannte Redewendung aus "Effi Briest" und nimmt auch
auf Fontane Bezug, hat aber mit der Effi-Briest-Geschichte nichts zu tun. Seine
Hauptgestalt ist der Fontane-Liebhaber Theo Wuttke (Fonty genannt), der sich unter
den Werken Fontanes vor allem für den Roman "Irrungen Wirrungen" interessiert und
für ihn einen bestimmten Erlebnis-Hintergrund erschließt bzw. 'erforscht'. Die beiden -
vermeintlich in Dresden - von Fontane gezeugten unehelichen Kinder
sollen demnach Kinder einer Gärtnerstochter gewesen sein, die Fontane sitzen
ließ und die dann als Lene Nimptsch in seinem Werk wiederkehrt. Wuttke alias Fonty
scheint oder wünscht, Urenkel eines dieser Kinder zu sein und damit in
direkter Linie von Fontane selbst abzustammen. Wahr ist an dieser Geschichte
freilich nichts, auch wenn Grass die Fontane-Forschung damit zunächst verblüffen
konnte, sie ist nicht einmal plausibel erfunden.  Das vorerst letzte Nachwirkungs-Zeugnis für Fontanes "Effi Briest" ist ein
Roman, der das Schicksal der Titelheldin in einer abenteuerlich anderen Variante
erzählt, die 1998 erschienene "Wahre Geschichte der Effi B." von Dorothea Keuler.
Das vorerst letzte Nachwirkungs-Zeugnis für Fontanes "Effi Briest" ist ein
Roman, der das Schicksal der Titelheldin in einer abenteuerlich anderen Variante
erzählt, die 1998 erschienene "Wahre Geschichte der Effi B." von Dorothea Keuler. 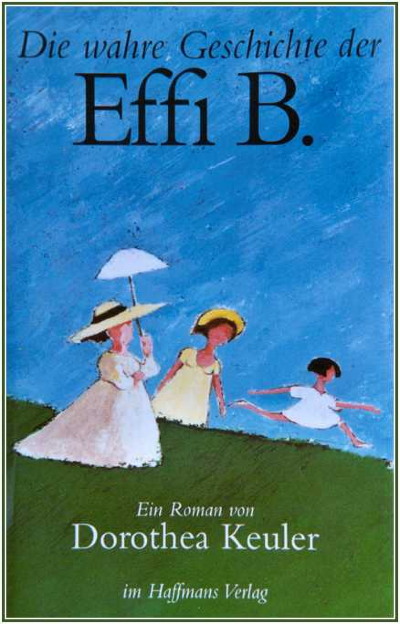 |
|
Die Erstausgabe der Effi-B.-Geschichte von Dorothea Keuler (1999 folgte ihr eine Taschenbuch-Ausgabe im Piper-Verlag)
|
 Die Geschichte geht so, dass Effis Mutter von Innstetten nicht nur verehrt worden ist,
sondern auch ein Kind von ihm bekommen hat: den zu Effis Vetter erklärten
Dagobert, der mithin ihr Halbbruder ist. Effi weiß davon jedoch nichts, heiratet
Innstetten und erfährt erst aus zufällig aufgefundenen Briefen von dem
früheren Verhältnis ihrer Mutter und einem Kind. Da man ihr dies verschwiegen
hat, nimmt sie an, dass sie selbst jenes Kind sei, mithin ihren Vater geheiratet
habe, und verlässt Innstetten ohne weitere Erklärung. Dieser verbreitet daraufhin die
Geschichte von ihrer Untreue in Kessin und dem Duell mit Crampas, der tatsächlich
jedoch selbst sich erschossen hat, weil Innstetten ihn der Bestechlichkeit
überführte. Heraus findet dies alles Effis Tochter Anni, als sie Dagobert
heiraten will, der ja ihr Onkel ist, und die familiären Widerstände dagegen
nicht versteht. Ergänzt wird die Handlung durch einen Mordversuch von Effis Mutter
an einer Zofe, die auf das Geheimnis des unehelichen Dagobert gekommen ist, durch ein
lesbisches Verhältnis Effis zu der Sängerin Trippelli, durch einen in mehrere
diese Umstände geheimnisvoll sich einmischenden Chinesen und weitere
überraschende Momente.
Die Geschichte geht so, dass Effis Mutter von Innstetten nicht nur verehrt worden ist,
sondern auch ein Kind von ihm bekommen hat: den zu Effis Vetter erklärten
Dagobert, der mithin ihr Halbbruder ist. Effi weiß davon jedoch nichts, heiratet
Innstetten und erfährt erst aus zufällig aufgefundenen Briefen von dem
früheren Verhältnis ihrer Mutter und einem Kind. Da man ihr dies verschwiegen
hat, nimmt sie an, dass sie selbst jenes Kind sei, mithin ihren Vater geheiratet
habe, und verlässt Innstetten ohne weitere Erklärung. Dieser verbreitet daraufhin die
Geschichte von ihrer Untreue in Kessin und dem Duell mit Crampas, der tatsächlich
jedoch selbst sich erschossen hat, weil Innstetten ihn der Bestechlichkeit
überführte. Heraus findet dies alles Effis Tochter Anni, als sie Dagobert
heiraten will, der ja ihr Onkel ist, und die familiären Widerstände dagegen
nicht versteht. Ergänzt wird die Handlung durch einen Mordversuch von Effis Mutter
an einer Zofe, die auf das Geheimnis des unehelichen Dagobert gekommen ist, durch ein
lesbisches Verhältnis Effis zu der Sängerin Trippelli, durch einen in mehrere
diese Umstände geheimnisvoll sich einmischenden Chinesen und weitere
überraschende Momente.  Natürlich ist dies alles nicht ernst gemeint, sondern soll demonstrieren,
was ein Kolportageroman aus dem Effi-Briest-Stoff machen kann oder könnte.
Indessen sind Travestien, wie man solche Formen nennt, nur so lange amüsant,
wie sie nicht in Willkür ausarten, und diese Grenze ist hier
überschritten. Nicht nur steckt das Ganze voller bizarrer Erfindungen, die
mit der Romanhandlung nichts zu tun haben, sondern es wird aus unerfindlichen
Gründen auch noch eine Zeitversetzung mit dieser vorgenommen. Das Geschehen
spielt hier erst nach 1900, also gegenüber "Effi Briest" um wenigstens zwanzig
Jahre verspätet, und so weiß man nicht, was die Aufnahme dieses Stoffes
überhaupt soll. Alle Bezüge auf Fontanes Roman laufen immer schon
insofern ins Leere, als man zeitlich in ihm gar nicht ankommt, von groben
Anachronismen auch in der gewählten Handlungszeit gar nicht gesprochen.
Der Titel "Effi B." ist also weiter nichts als ein Lockangebot, zu dem die
versprochene gute Unterhaltung ausbleibt. Geboten wird allenfalls Zerstreuung,
und wer dieses Buch überhaupt zu Ende liest, wird sicher nach kürzester
Zeit vergessen haben, wovon darin die Rede ist. So kritisch auch immer man Fontanes
Roman ansehen kann - sein Werk ist von anderem Gewicht, es gibt
auch nach wiederholter Lektüre noch Anlass zum Nachdenken.
Natürlich ist dies alles nicht ernst gemeint, sondern soll demonstrieren,
was ein Kolportageroman aus dem Effi-Briest-Stoff machen kann oder könnte.
Indessen sind Travestien, wie man solche Formen nennt, nur so lange amüsant,
wie sie nicht in Willkür ausarten, und diese Grenze ist hier
überschritten. Nicht nur steckt das Ganze voller bizarrer Erfindungen, die
mit der Romanhandlung nichts zu tun haben, sondern es wird aus unerfindlichen
Gründen auch noch eine Zeitversetzung mit dieser vorgenommen. Das Geschehen
spielt hier erst nach 1900, also gegenüber "Effi Briest" um wenigstens zwanzig
Jahre verspätet, und so weiß man nicht, was die Aufnahme dieses Stoffes
überhaupt soll. Alle Bezüge auf Fontanes Roman laufen immer schon
insofern ins Leere, als man zeitlich in ihm gar nicht ankommt, von groben
Anachronismen auch in der gewählten Handlungszeit gar nicht gesprochen.
Der Titel "Effi B." ist also weiter nichts als ein Lockangebot, zu dem die
versprochene gute Unterhaltung ausbleibt. Geboten wird allenfalls Zerstreuung,
und wer dieses Buch überhaupt zu Ende liest, wird sicher nach kürzester
Zeit vergessen haben, wovon darin die Rede ist. So kritisch auch immer man Fontanes
Roman ansehen kann - sein Werk ist von anderem Gewicht, es gibt
auch nach wiederholter Lektüre noch Anlass zum Nachdenken.