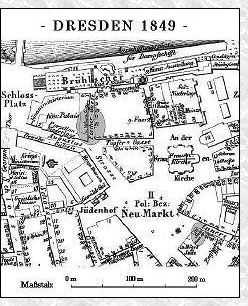|
|
|
|
Das alles möchte zum Beweis einer Bekanntschaft aber vielleicht immer noch nicht genügen, gäbe es in Fontanes Werk nicht eine Figur, die dieser Dresdner Witwe in erstaunlicher Weise entspricht. Es ist in Stine die Witwe Pittelkow, eine Frau, die von Männerbekanntschaften lebt, während gleichzeitig ihre Schwester Stine, so die Handlung, die aus diesem Milieu heraus will, mit ihrer Liebe zu einem jungen Grafen scheitert. Die Ähnlichkeit zwischen den beiden Witwen beginnt schon bei den Namen: hier Auguste Klein, geborene Freygang, dort Pauline Pittelkow, geborene Rehbein - von einer Art assoziativer Verwandtschaft wird man sprechen dürfen.24) Aber auch, daß überhaupt das 'geb. Rehbein' in dem Roman so deutlich ausgewiesen wird25), ist bemerkenswert, insofern es nicht einen einzigen Hinweis darauf gibt, wer |S:221|der
Aufschlußreich ist aber auch, was Fontane von der Vorgeschichte der Ehe Pittelkow mitteilt. Pauline sei "kaum zwanzig" gewesen, heißt es, als ihre erste Tochter geboren wurde, "eine gewöhnliche Verführungsgeschichte". Doch da man "ihren Anspruch mit einer hübschen Geldsumme zufriedenstellte, so war sie nun eine 'gute Partie' geworden und verheiratete sich auch bald danach."29) Das ist dieselbe Konstellation, die man aus den Heiratsumständen der Auguste Freygang ableiten kann - nur daß bei ihr die 'gewöhnliche Verführungsgeschichte' plus Abfindung ein bißchen gewöhnlicher erst beim zweiten Kind stattfand, was Fontane aber noch nicht einmal gewußt haben muß. Als sie mit 31 Jahren Witwe wurde, war jedenfalls ihr ältestes Kind genau wie das älteste der Witwe Pittelkow zehn Jahre alt, und auch das jüngste dürfte deren jüngstem mit einem Alter von zwei Jahren etwa entsprochen haben.30) Daß sie zusätzlich zu diesen beiden noch drei weitere Kinder hatte, bedeutet als Abweichung von der Situation der in ihrer Ehe kinderlosen Pauline nicht viel. Auch dies ist nur der gewöhnlichere Fall, und diesen, also die höhere Kinderzahl, konnte Fontane für seinen Roman nicht gebrauchen. Auch Pauline sieht ja in weiteren unehelichen Kindern kein Problem und sagt über solche Folgen gelegentlicher Liebschaften recht gelassen zu Stine: "Was ist denn groß? Na, dann läuft 'ne Olga mehr in der Welt rum, und in vierzehn Tagen kräht nich Huhn nich Hahn mehr danach."31) Und auch noch den Zug von "Eitelkeit und Gefallsucht", der an der Witwe Pittelkow bemerkt wird32), kann man an der Dresdner Witwe erkennen: statt des etwas profanen 'Auguste' gibt sie später ihren dritten Vornamen Adelheid als ihren Rufnamen an. Das heißt nun nicht, daß die Romanfigur ein schlichtes Porträt sein wird. Schon daß sie eine so dezidiert berlinische Figur ist, widerspricht dem, wenn schon es mit der Rückgewinnung eines sächsischen Urbildes noch die geringsten Schwierigkeiten gäbe. Aber auch sonst hat Fontane so ja nicht gearbeitet. Gewiß ist also die Witwe Pittelkow in allem ansehnlicher, liebenswürdiger, in sich stimmiger usw. als jedes dazu denkbare Original - und könnte doch Züge von einem solchen bewahren. Man könnte an die Eingangssituation denken, wo Pauline Pittelkow, auf dem Fensterbrett stehend und 'kniehoch aufgeschürzt', mit Feuereifer die Fenster putzt, so daß sich die |S:223|Nachbarinnen schon mokieren, wie sie den Männern mit ihrem Auftritt mal wieder die Köpfe verdreht. Oder es könnte - ebenfalls in der Eingangsszene - der Umgang mit ihrer zehnjährigen Tochter sein, der sie eine Strafpredigt androht, weil sie ihre kleine Schwester geohrfeigt hat. Eine ganz ähnliche Szene findet sich hierzu in einer fragmentarischen Vorstudie zu dem Roman, wo gerade in diesem Moment ein junger Mann - ein zusätzliches Erlebnis-Indiz - das Haus betritt, um bei ihr wegen eines Zimmer anzufragen. In diesem Fall ist es "eine junge Frau von 30, blond, voll und mit merkwürdig leuchtenden hellblauen Augen"33), die ihm entgegentritt, während die spätere Pauline als brünett beschrieben wird und eher das "Bild einer südlichen Schönheit" abgibt.34) Attribute wie diese sind also austauschbar, können der Konsistenz des Typs jedoch nichts anhaben. Und schließlich ist auch noch an die sehr detaillierte Beschreibung ihrer Wohnung zu denken, für die zumal ein altes Ölporträt, das einen "polnischen oder litauischen Bischof" zeigt, und zwei "jämmerliche Gipsfiguren", eine Polin und ein Pole in Nationaltracht, als ungewöhnlich ins Auge fallen.35) Als Zeugnisse polnischer Nationalkultur passen beide Stücke nämlich weit besser in das einst mit der polnischen Krone verbundene Sachsen als in das strikt protestantische und antipolnische Berlin, wo sie zu Zeiten des Kulturkampfes fast schon Protestsignale gewesen wären. Nicht vergessen werden darf aber auch, daß Fontane stets eine besondere Vorliebe für die Figur der Witwe Pittelkow gehabt hat. "Die Hauptperson ist nicht Stine", schreibt er schon vor der Veröffentlichung an den potentiellen Herausgeber Emil Dominik, "sondern deren ältere Schwester: Witwe Pittelkow. Ich glaube, sie ist eine mir gelungene und noch nicht dagewesene Figur."36) Ähnlich nennt er sie Paul Schlenther gegenüber eine der "besten Figuren meiner Gesamtproduktion", und an Maximilian Harden schreibt er, sie sei ihm "als Figur viel wichtiger als die ganze Geschichte". In ein Exemplar des Romans aber, das er 1891 für die Tombola des Berliner Pressefestes stiftet, setzt er die bekannten Widmungsverse38): | |
Was ist aus dem Kind geworden? Es starb früh, schon am 27. Juni 1849 ist sein Tod im Kirchenbuch der Kreuzkirche verzeichnet.41) Sofern Fontane davon überhaupt so bald erfahren hat, folgte finanziell daraus für ihn aber jedenfalls nichts. Seine "Geldkalamitäten"42) deuten auf eine einmalige Abfindungszahlung hin, zu mehr wäre er wegen der Ungewißheit der Vaterschaftszuschreibung auch wohl kaum bereit gewesen. Und eben solches gilt gewiß auch für das andere, das erste Kind. Wegen der zeitlichen Nähe zum zweiten kann es nur von einer anderen Frau und dürfte demnach in Berlin geboren worden sein, doch ist auch hier Fontane als unehelicher Vater nicht verzeichnet.43) Auch hier wird es sich also um ein 'Vater-unbekannt-Kind' gehandelt haben, nur daß es deren damals in Berlin so viele gab, daß sich ohne weitere Anhaltspunkte jede Nachforschung erübrigt. Für sein gleich doppeltes Mißgeschick vermutlich im Jahre 1848 aber ist ganz im Ernst darauf hinzuweisen, daß dies das Revolutionsjahr war. Es brachte nach vielen Zeitzeugnissen auch eine Lockerung der Sitten mit sich, und an Begegnungen mit Frauen hat es ihm in seiner Apotheke wahrlich nicht gefehlt. "Keine Revolution ohne allgemeine Kopulation", lautet verkürzt ein sarkastischer Spruch aus Peter Weissens Marat44) - Preußen während der Märzkämpfe wird da keine Ausnahme gemacht haben. |