| Die Schauplätze |  |
 |
 |
 |

 |
|
Das National-Panorama (Rundbau rechts) und das Gebäude des preußischen
Generalstabs (links) vor dem Neubau der Moltke-Brücke am Spreebogen (Foto von Hermann
Rückwardt 1889).
|
 |
|
Das National-Panorama (1) nahe der Stelle des heutigen Bundeskanzleramtes,
der Lehrter Bahnhof (2) an der Stelle des heutigen Zentralbahnhofes und der
Stettiner Bahnhof (3).
|


 |
|
Der 1876 eröffnete Stettiner Bahnhof war in jener Zeit von den acht Berliner
Fernbahnhöfen der mit dem größten Fahrgastaufkommen, da über
ihn vor allem der Urlauberverkehr mit der Ostsee ablief.
|
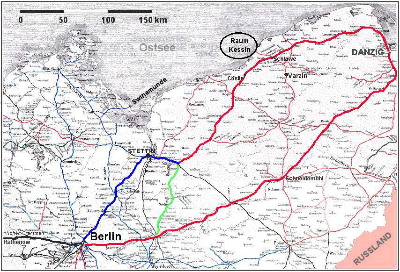 |
|
Das Netz der preußischen Staatsbahn im Jahre 1885 mit den Direktionen Berlin (blau),
Bromberg (rot) und Magdeburg (schwarz) sowie die Stargard-Cüstriner Eisenbahn (grün).
|

 Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,
ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.
Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde
denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat
und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung
Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,
die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten
Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,
dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni
1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen
weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in
Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei
nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden
deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.
Die Lage Kessins ist durch die Nähe zu Varzin, dem Gut Bismarcks in Pommern,
ziemlich genau bestimmt, aber einen Ort dieses Namens gibt es in dieser Gegend nicht.
Man könnte ihn sich an die Stelle von Rügenwalde bzw. Rügenwaldermünde
denken, doch hat Fontane diese Gegend nicht gekannt. Wie er selbst erklärt hat
und sich aus dem Roman auch ergibt, hat er sich vielmehr für die Beschreibung
Kessins und seiner Umgebung ganz an Swinemünde (heute Swinoujscie) gehalten,
die Stadt am Ostende von Usedom, in der er zwischen seinem achten und dreizehnten
Lebensjahr selbst gelebt hat. "... Kessin,
dem ich die Scenerie von Swinemünde gegeben habe", bekennt er in einem Brief vom 12. Juni
1895 an Anna Catharina Mayer. Die Varziner Gegend wird nur durch einen einzigen
weiteren geographischen Namen in dem Roman noch berührt, Köslin, als es in
Kapitel 19 über den Wohlstand des Oberförsters Ring heißt, seine Mutter sei
nur "eine Plättfrau aus Köslin" gewesen. Die lokalen Einzelheiten Kessins werden
deshalb fortan nach dem Bild des rund 180 km weiter westlich gelegenen Swinemünde dargestellt.

 |
|
Die pommersche Küste hinter Köslin (heute Koselice) - der angedeutete
geographische Raum für die erfundene Stadt Kessin.
|

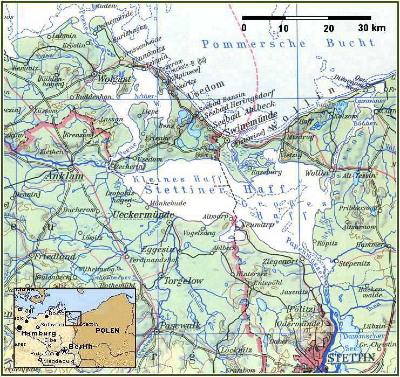 |
|
Die pommersche Küste mit Stettin, Usedom und Swinemünde, dem tatsächlichen
Vorstellungs-Raum für die Kessiner Handlung.
|
 Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen
Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde
'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der
Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es
wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.
Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,
sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro
Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000
Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,
wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln
aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren
der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau
keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und
Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und
Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und
geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,
in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es
dorthin zu projizieren.
Dass Kessin seinem Profil nach Swinemünde ist, zeigt sich zunächst an einigen
Namens-Parallelen. Die Uferstraße heißt hier wie die von Swinemünde
'Bollwerk', das zwischen der Stadt und dem Meer liegende Wäldchen 'Plantage' (in der
Bedeutung von 'Pflanzung', urbar gemachtes Sumpfland), an der Kessine-Mündung gibt es
wie an der Swine zwei Molen und in der Umgebung noch das Dorf Morgenitz und den Gothensee.
Die Größe der Stadt entspricht allerdings nicht derjenigen Swinemündes von 1880,
sondern ist die der ersten Jahrhunderthälfte. Es ist eine Stadt von 3000 Einwohnern mit pro
Saison 1500 Badegästen (Swinemünde hatte um 1880 schon 10 000 Einwohner und 15 000
Badegäste), und auch ihre gesellschaftliche Dürftigkeit kennzeichnet Fontane ganz so,
wie er es 1893 in "Meine Kinderjahre" für Swinemünde tut. Es gibt zwar Konsuln
aus vieler Herren Länder und Schiffsverkehr über die Ostsee, aber die Honoratioren
der Stadt sind eher Originale als 'feine Leute' und stellen für einen Landrat und seine Frau
keinen rechten Umgang dar. Viel deutlicher noch aber erweist sich die Identität von Kessin und
Swinemünde in den Raumverhältnissen. Sämtliche in "Effi Briest" vorkommenden Orts- und
Richtungsangaben lassen sich problemlos in einen Swinemünder Stadtplan übertragen und
geben dann für die Handlung die passenden Aufschlüsse. Es ist wirklich diese Stadt,
in der sich Fontane das Kessiner Geschehen vorgestellt hat - und so ist es auch sinnvoll, es
dorthin zu projizieren.

 |
|
Die Stadt Kessin in den Konturen von Swinemünde (mit Links zu den zugehörigen
Romanstellen hinterlegt).
|
 Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -
in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark
verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung
treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die
früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den
späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht
mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig
Jahre nach seinem Weggang von dort noch einmal besuchte, auch selbst registriert, war sich
also dieses Gegensatzes völlig bewusst. In einem Brief an seine Frau vom 24. August 1863
schreibt er:
Schwieriger allerdings ist es, diesen Schauplatz - oder Fontanes Vorstellungen davon -
in Bildern wiederzugeben. Swinemünde hat sich während des 19. Jahrhunderts stark
verändert, so dass sich das Stadtbild von 1830 und das Milieu von 1880 in keiner Abbildung
treffen. In den Zeichnungen aus dem frühen 19. Jahrhundert sind natürlich auch die
früheren Lebensverhältnisse sichtbar und sind der Handlung nicht angemessen, und in den
späteren Fotos zeigt sich zwar das richtige Milieu, aber das gemeinte Stadtbild ist nicht
mehr vorhanden. Fontane selbst hat diesen Wandel, als er Swinemünde dreißig
Jahre nach seinem Weggang von dort noch einmal besuchte, auch selbst registriert, war sich
also dieses Gegensatzes völlig bewusst. In einem Brief an seine Frau vom 24. August 1863
schreibt er:

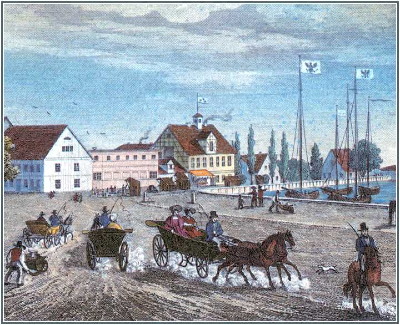 |
|
Das 'alte Fachwerkhaus' des Hotels "Drei Kronen" im Jahre 1837.
(Ausschnitt aus einem Stahlstich von Friedrich Rosmäßler, Stadtmuseum Berlin)
|


 |
|
Das Hotel "Drei Kronen" im Jahre 1880.
|
 Und über die Stadt heißt es:
Und über die Stadt heißt es:

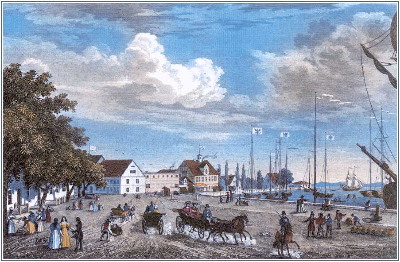 |
|
Die Straße am Swine-Ufer - das Obere Bollwerk - mit dem fahnengeschmückten Hotel 'Drei Kronen'.
(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)
|
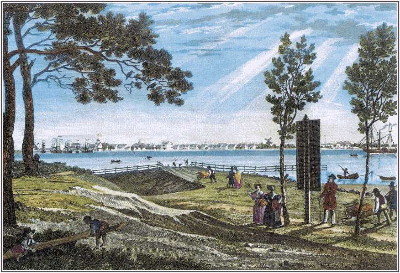 |
|
Die Bollwerkspartie am Swine-Ufer von der alten Fähre gesehen.
(Stahlstich von Friedrich Rosmäßler von 1837, Stadtmuseum Berlin)
|
