Forschungsprofil
Meine wissenschaftliche Arbeit in den Bereichen Philosophie (Studium und Promotion) und Geschichte (Habilitation) dreht sich um die folgende wiederkehrende Frage: Welche produktiven, wenn auch unzureichenden Strategien, haben die Menschen hervorgebracht und arbeiten sie immer wieder neu aus, um der Unwiederbringlichkeit der Vergangenheit abzuhelfen – oder sich damit abzufinden?
Zum einen habe ich die literarischen Kataloge als die höchste Form der Verdichtung erkundet, Vergangenheit zu tradieren. In meinem ersten Buch „Selektion und Katalog. Die Konstruktion der Vergangenheit bei Homer, Dante und Primo Levi“ (2008) habe ich die ethische Aporie untersucht, die die literarische Selektionsarbeit mit sich bringt, sobald die Erzählung die Last des historischen Gedächtnisses auf sich nimmt. Es bietet eine systematische, problemorientierte Auseinandersetzung mit dem Selektionsbegriff vom (Sozial-)Darwinismus bis zu Hans Blumenbergs Rezeptionsästhetik, die in der Philosophie und vor allem in der Literaturwissenschaft Widerhall findet.
Mit dem Begriff schriftlose Vergangenheiten (2019) habe ich ein methodisches und epistemisches Problemfeld skizziert, das die Grenzen der historischen Rekonstruktion aufzeigt. Da sich die Geschichtswissenschaft trotz ihres breiten Quellenverständnisses in erster Linie als eine auf schriftlichen Überlieferungen basierende Wissenschaft versteht, stellen diese schriftlosen Vergangenheiten eine Herausforderung für die historische Erkenntnis dar. Die interdisziplinären Beiträge in dem von mir herausgegebenen Band „Schriftlose Vergangenheiten. Geschichtsschreibung an ihrer Grenze“ zeigen Wege auf, wie mit diesen Problemen umgegangen werden kann und inwieweit sich dadurch das Verständnis und die Konzeption der Geschichtsschreibung verändern.
Daran anschließend bin ich in meinem Buch „Geschichtsdinge“ der Frage nachgegangen, wie Gelehrte im 18. und frühen 19. Jahrhundert das Wissen über das alte Gallien mithilfe von neuartigen Quellen materieller, aber auch immaterieller Natur konstruiert haben. Diese Studie verfolgt den Erkenntnisprozess von der Betrachtung eines Objekts als Zeugnis der Vergangenheit über die Praktiken und Methoden, mit denen es zum Sprechen gebracht wurde, bis hin zu seiner Einbettung in historische Erzählungen. Indem die Untersuchung das Denkmal als ‚Geschichtsding‘ gegenüber dem ‚Gedenkding‘ in den Mittelpunkt stellt, bietet sie den ersten systematischen Versuch, eine Denkmalepisteme zu entwerfen. Damit liefert diese Studie einen Beitrag zu einer noch zu schreibenden historischen Epistemologie, die sich auf die Historizität der jeweiligen epochenspezifischen Spezies von Zeugnissen konzentriert.
Im Mittelpunkt meiner aktuellen Forschung steht die Relation zwischen Geschichte, Zeitlichkeit und Materialität, die im Rahmen einer zu erarbeitenden „Kritik geschichtlicher Materialität“ zu erkunden und systematisch zu erfassen ist. Diese Forschungsperspektive hat sich im Verlauf meiner langjährigen Beschäftigung mit dem frühneuzeitlichen Antiquarianismus und den wissenschaftlichen Sammlungen als Orten der Wissensproduktion herausgebildet (https://sammlungen.uni-frankfurt.de). Die jüngsten theoretischen Reflexionen, die im Zusammenspiel mit konkreter Arbeit an meiner „Theory-Oriented Object Collection“ und mit der „Figurensammlung Reinhart Koselleck“ entstanden, sind in Publikationen dargelegt, u. a. in dem Aufsatz „The Uncertain Stuff of History“ (2024) sowie in den drei Beiträgen des von mir herausgegebenen Sammelbandes „Im Zwischenraum der Dinge“ (2023).


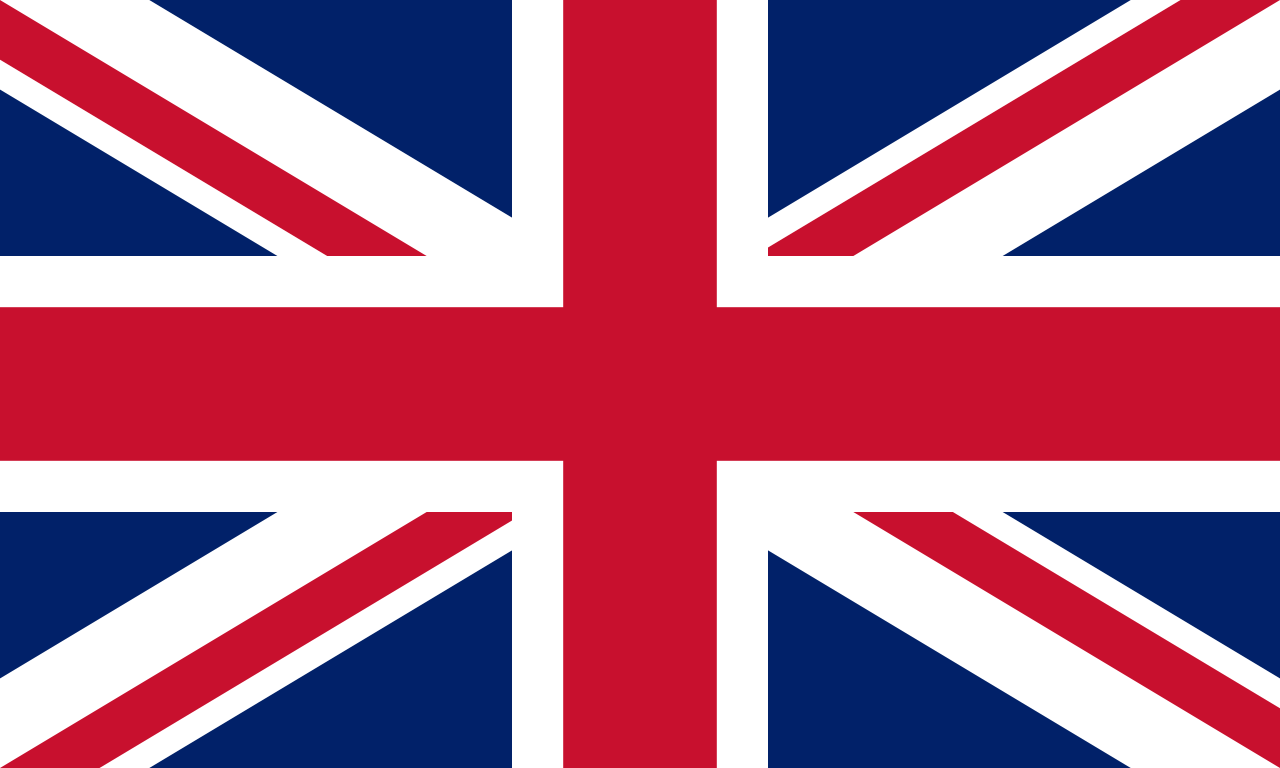 Englisch
Englisch 
