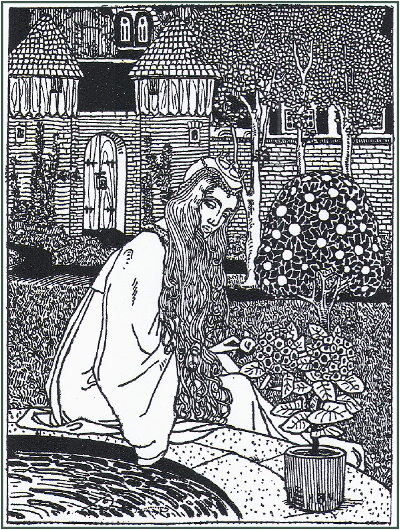- 7 -
 "Weil es nicht selten geschieht, dass ein Geschlecht mit praktischen, bürgerlichen
und trockenen Traditionen sich gegen das Ende seiner Tage noch einmal durch die Kunst verklärt. "
"Weil es nicht selten geschieht, dass ein Geschlecht mit praktischen, bürgerlichen
und trockenen Traditionen sich gegen das Ende seiner Tage noch einmal durch die Kunst verklärt. "
Thomas Mann zitiert hier gewissermaßen sich selbst - nämlich mit der Leitidee seiner 'Buddenbrooks' (1901), dem
'Verfall einer Familie', wie der Untertitel lautet. Auch dort gibt es den allmählichen wirtschaftlichen Abstieg und in der
vorletzten Generation die Hinwendung zur Musik, in diesem Falle als Geigenspiel bei Gerda Buddenbrook. Hanno, der letzte des
Geschlechtes, ist in seiner musischen Veranlagung dann schon nicht mehr recht lebensfähig und stirbt mit 16 Jahren. Den
Hintergrund für diese Idee bildet natürlich das Schicksal der Herkunftsfamilie Thomas Manns in Lübeck, deren
kaufmännische Tradition mit seinem Vater endet und in der er selbst sich als Künstler auf der letzten Stufe sieht (Weiteres
siehe unter
ENTSTEHUNG).
~~~~~~~~~~~~
 "In der Mitte war ein Springbrunnen, mit einem dichten Kranz von Schwertlilien umgeben. Im
Sommer verbrachte ich dort lange Stunden mit meinen Freundinnen. Wir saßen alle auf kleinen Feldsesseln
rund um den Springbrunnen herum ... "
"In der Mitte war ein Springbrunnen, mit einem dichten Kranz von Schwertlilien umgeben. Im
Sommer verbrachte ich dort lange Stunden mit meinen Freundinnen. Wir saßen alle auf kleinen Feldsesseln
rund um den Springbrunnen herum ... "
Auch diese Szene erinnert an die 'Buddenbrooks'. Dort sitzt - Dritter Teil, Erstes Kapitel - die ganze Familie Buddenbrook an
einem Sommernachmittag im Garten, als Herr Grünlich vorspricht, der es auf die 18-jährige Tony Buddenbrook
abgesehen hat und sehr bald um ihre Hand anhält.
Darüber hinaus sind solche Brunnen-Szenen auch ein beliebtes Jugendstil-Motiv, benutzt z.B. als Frontispiz
in Alfred Heymels Erzählung "Ritter Ungestüm" aus dem Jahre 1900, die Thomas Mann als
Veröffentlichung des Insel-Verlages sicherlich kannte.
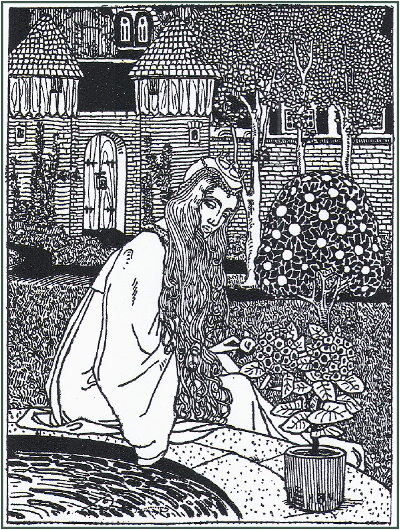
|
|
Das Titelbild eines Insel-Bändchens von 1900.
|
- 8 -
 "Und gestern Nachmittag hat Fräulein von Osterloh in aller Eile die 'Klosterglocken' gespielt", bemerkte Herrn
Klöterjahns Gattin.
"Und gestern Nachmittag hat Fräulein von Osterloh in aller Eile die 'Klosterglocken' gespielt", bemerkte Herrn
Klöterjahns Gattin.
Klosterglocken = "Les cloches du monastére" von Louis Lefébure-Wely (1817-1870), ein typisches Stück
Salonmusik aus dem 19. Jahrhundert, das auch später noch viel gespielt wurde. An den Pianisten stellt es durchaus
nicht geringe Anforderungen, soll hier also nicht so sehr Fräulein von Osterlohs Fähigkeiten in Zweifel ziehen als vielmehr
ihren Geschmack.
 Die Klosterglocken (opus 54) von Lefébure-Wely , gespielt von Hans Kann (Salonmusik, Preiser Records 1993).
Die Klosterglocken (opus 54) von Lefébure-Wely , gespielt von Hans Kann (Salonmusik, Preiser Records 1993).
~~~~~~~~~~~~

... Sie spielte das Nocturne in Es-Dur, opus 9, Nummer 2 ... Unter ihren Händen sang die Melodie ihre letzte
Süßigkeit aus ...
Nocturne = unter den 20 'Nachstücken', die Frédéric Chopin (1810-1849) komponiert hat, ist das
zweite in Es-Dur wegen seiner eingängigen Melodie wahrscheinlich das bekannteste. Da es zugleich zu den leichter zu spielenden
gehört, wurde es auch bei Hauskonzerten oft vorgetragen.
 Das Nocturne Nr. 2 (Es-Dur, opus 9, Nr. 2) von Chopin, gespielt von Claudio Arrau (Philips Classics 1997).
Das Nocturne Nr. 2 (Es-Dur, opus 9, Nr. 2) von Chopin, gespielt von Claudio Arrau (Philips Classics 1997).
~~~~~~~~~~~~
 "... Also geben Sie", sagte sie einfach, stellte die Noten aufs Pult, setzte sich und begann nach einem Augenblick
der Stille mit der ersten Seite.
"... Also geben Sie", sagte sie einfach, stellte die Noten aufs Pult, setzte sich und begann nach einem Augenblick
der Stille mit der ersten Seite.
Richard Wagners Oper "Tristan und Isolde", 1859 abgeschlossen, 1865 in München uraufgeführt, wird von Thomas Mann hier
als bekannt vorausgesetzt. Der Inhalt ist der folgende:
1.Aufzug:
Der junge Ritter Tristan aus Kornwall hat für seinen alternden König Marke um die Irenprinzessin Isolde
geworben und führt sie ihm per Schiff zu. Isolde aber liebt nur Tristan, den sie schon einmal gesund gepflegt hat,
als er verletzt zu ihr nach Irland gekommen war. Um ihre Liebesqualen abzukürzen, will sie ihn und sich selbst noch
vor der Ankunft in Kornwall töten. Statt des Todestranks reicht sie ihm aber den von ihrer Dienerin Brangäne
versehentlich gebrachten Liebestrank, und beide sind sich fortan verfallen.
2.Aufzug: Im Schloss
zu Kornwall kommt es zu einer ersten Liebesnacht, als König Marke mit seinem Gefolge zur Jagd ausgezogen ist. Am Morgen
wird das Paar von der rückkehrenden Jagdgesellschaft überrascht. Tristan wird angegriffen und verletzt, kann aber von
seinem Diener Kurwenal in Sicherheit gebracht werden.
3.Aufzug:
Krank und verzweifelt liegt Tristan im Schloss von Kurwenal und hofft auf die Ankunft von Isolde, die ihn wiederum heilen soll. Als sie
eintrifft, schleppt er sich ihr entgegen und sinkt sterbend zu ihren Füßen nieder. Isolde gefolgt ist König
Marke, der von dem Liebestrank erfahren hat und beiden verzeihen will. Isolde aber erträgt den Tod Tristans nicht und stirbt
ihm nach.
~~~~~~~~~~~~
 Sie spielte den Anfang mit einer ausschweifenden und quälenden Langsamkeit, mit beunruhigend gedehnten
Pausen zwischen den einzelnen Figuren.
Sie spielte den Anfang mit einer ausschweifenden und quälenden Langsamkeit, mit beunruhigend gedehnten
Pausen zwischen den einzelnen Figuren.
Die Oper beginnt mit einem 'Vorspiel', zu dem Wagner selbst erklärt hat, dass es die ganze
Liebesgeschichte von Tristan und Isolde thematisch umfasse. Von dem schüchternsten Bekenntnis, der
zartesten Hingezogenheit an, durch banges Seufzen, Hoffen und Zagen, Klagen und Wünschen, Wonnen und
Qualen, bis zum mächtigsten Andrang, zur gewaltsamsten Mühe, den Durchbruch zu finden, werde alles
darin ausgedrückt, was dem Liebespaar den Weg in das Meer unendlicher Liebeswonne eröffne.
Am Ende aber stehe die Wonne des Sterbens, des Nicht-mehr-Seins, der letzten Erlösung ... Nennen wir es
Tod? Oder ist es die nächtige Wunderwelt, aus der, wie die Sage uns meldet, ein Efeu und eine Rebe in inniger Umschlingung
einst auf Tristans und Isoldes Grab emporwuchsen?
Das ist dieselbe hymnische Sprechweise, in der auch Thomas Mann hier über das Vorspiel sich äußert, es
ist davon auszugehen, dass er Wagners Selbstbeurteilung gekannt hat. - Die langsame Eingangspassage hört sich so an:
 Der Anfang des 'Vorspiels' zu "Tristan und Isolde", gespielt vom BBC Philharmonic Orchester unter Vasil
Kazandjiev (1990).
Der Anfang des 'Vorspiels' zu "Tristan und Isolde", gespielt vom BBC Philharmonic Orchester unter Vasil
Kazandjiev (1990).
 Das Sehnsuchtsmotiv, eine einsame und irrende Stimme in der Nacht, ließ leise seine bange Frage vernehmen.
Eine Stille und ein Warten. Und siehe, es antwortet: derselbe zage und einsame Klang, nur heller, nur zarter.
Das Sehnsuchtsmotiv, eine einsame und irrende Stimme in der Nacht, ließ leise seine bange Frage vernehmen.
Eine Stille und ein Warten. Und siehe, es antwortet: derselbe zage und einsame Klang, nur heller, nur zarter.
 Das 'Sehnsuchts-Motiv' und seine Wiederholung etwas höher.
Das 'Sehnsuchts-Motiv' und seine Wiederholung etwas höher.
 Da setzte mit jenem gedämpften und wundervollen Sforzato, das ist wie ein Sich-Aufraffen und seliges Aufbegehren der
Leidenschaft, das Liebesmotiv ein, stieg aufwärts, rang sich entzückt empor bis zur süßen Verschlingung,
sank, sich lösend, zurück, und mit ihrem tiefen Gesange von schwerer, schmerzlicher Wonne traten die Celli hervor und
führten die Weise fort ...
Da setzte mit jenem gedämpften und wundervollen Sforzato, das ist wie ein Sich-Aufraffen und seliges Aufbegehren der
Leidenschaft, das Liebesmotiv ein, stieg aufwärts, rang sich entzückt empor bis zur süßen Verschlingung,
sank, sich lösend, zurück, und mit ihrem tiefen Gesange von schwerer, schmerzlicher Wonne traten die Celli hervor und
führten die Weise fort ...
 Die Entwicklung des 'Liebesmotivs' aus dem Vorspiel.
Die Entwicklung des 'Liebesmotivs' aus dem Vorspiel.
~~~~~~~~~~~~
 Zwei Kräfte, zwei entrückte Wesen strebten in Leiden und Seligkeit nacheinander und umarmten sich in
dem verzückten und wahnsinnigen Begehren nach dem Ewigen und Absoluten ... Das Vorspiel flammte auf und neigte sich.
Zwei Kräfte, zwei entrückte Wesen strebten in Leiden und Seligkeit nacheinander und umarmten sich in
dem verzückten und wahnsinnigen Begehren nach dem Ewigen und Absoluten ... Das Vorspiel flammte auf und neigte sich.
 Das Vorspiel im ganzen.
Das Vorspiel im ganzen.
~~~~~~~~~~~~
 "Den zweiten Aufzug", flüsterte er; und sie wandte die Seiten und begann mit dem zweiten Aufzug.
"Den zweiten Aufzug", flüsterte er; und sie wandte die Seiten und begann mit dem zweiten Aufzug.
Der erste Aufzug wird überblättert, dem Vorspiel folgt gleich der zweite Aufzug mit der Liebesnacht von Tristan
und Isolde. Die nachfolgenden Absätze beruhen in ihrer Wortwahl weitgehend auf dem Text der zweiten Szene des zweiten Aufzugs.
~~~~~~~~~~~~
 Hörnerschall verlor sich in der Ferne. Wie? oder war es das Säuseln des Laubes? Das sanfte Rieseln des Quells?
Schon hatte die Nacht ihr Schweigen durch Hain und Haus gegossen, und kein flehendes Mahnen vermochte dem
Walten der Sehnsucht mehr Einhalt zu tun. Das heilige Geheimnis vollendete sich. Die Leuchte erlosch ...
Hörnerschall verlor sich in der Ferne. Wie? oder war es das Säuseln des Laubes? Das sanfte Rieseln des Quells?
Schon hatte die Nacht ihr Schweigen durch Hain und Haus gegossen, und kein flehendes Mahnen vermochte dem
Walten der Sehnsucht mehr Einhalt zu tun. Das heilige Geheimnis vollendete sich. Die Leuchte erlosch ...
Die betreffenden Stellen in II,1 des Wagner'schen Librettos lauten (Isolde spricht hier zu ihrer Dienerin Brangäne):
|
Hörst du sie noch?
Mir schwand schon fern der Klang.
...
Dich täuscht des Laubes
säuselnd Getön,
das lachend schüttelt der Wind.
...
Nicht Hörnerschall
tönt so hold,
des Quelles sanft
rieselnde Welle
rauscht so wonnig daher.
...
O gib das Zeichen!
Lösche des Lichtes
letzten Schein!
Dass ganz sie sich neige,
winke der Nacht.
Schon goss sie ihr Schweigen
durch Hain und Haus,
schon füllt sie das Herz
mit wonnigem Graus.
O lösche das Licht nun aus,
lösche den scheuchenden Schein!
Lass meinen Liebsten ein!
|
~~~~~~~~~~~~
 Wer liebend des Todes Nacht und ihr süßes Geheimnis erschaute, dem blieb im Wahn des Lichtes ein einzig Sehnen, die Sehnsucht hin zur heiligen Nacht, der ewigen, wahren, der einsmachenden ...
Wer liebend des Todes Nacht und ihr süßes Geheimnis erschaute, dem blieb im Wahn des Lichtes ein einzig Sehnen, die Sehnsucht hin zur heiligen Nacht, der ewigen, wahren, der einsmachenden ...
Die betreffende Stelle in II,2 des Wagner'schen Librettos lautet:
|
Wer des Todes Nacht
liebend erschaut,
wem sie ihr tief
Geheimnis vertraut:
des Tages Lügen,
Ruhm und Ehr,
Macht und Gewinn,
so schimmernd hehr,
wie eitler Staub der Sonnen,
sind sie vor dem zersponnen!
In des Tages eitlem Wähnen
bleibt ihm ein einzig Sehnen -
das Sehnen hin
zur heil'gen Nacht,
wo urewig
einzig wahr
Liebeswonne ihm lacht!
|
Auch hier wird wieder der Operntext aus dem 2. Aufzug zitiert.
Mit ihrem 'Habet acht! - Bald entweicht die Nacht' warnt Brangäne das Liebespaar vor dem anbrechenden Tag und damit vor
der Gefahr des Entdecktwerdens. Von den Violinen wird noch einmal das Motiv des 'Liebestraumes' angestimmt, das bereits dem Duett 'Bricht mein Blick sich' zugrunde liegt.
Die Erklärung Spinells kann nur lauten, dass der Liebende sich selbst zur Welt wird, nichts anderes als sich und seine Liebe kennt.
Der Liebesnacht-Szene folgt sofort der Schluss, Isoldes Liebestod, sodass also die dritte Szene des zweiten und der größte
Teil des dritten Aufzuges weggelassen sind. Das hat nicht nur den Grund, dass eine noch längere Dauer von Gabrieles Klavierspiel
unwahrscheinlich wäre, es ist auch thematisch gemeint: Liebe und Tod sind in dieser Oper unmittelbar aufeinander bezogen.