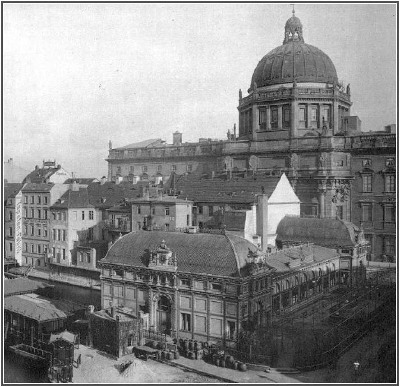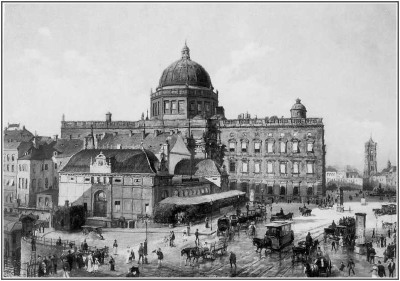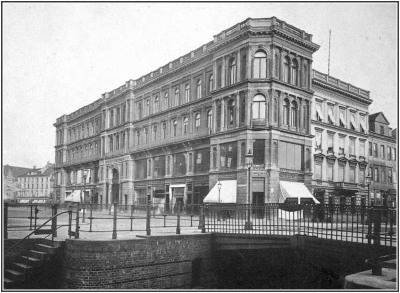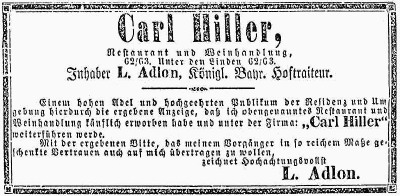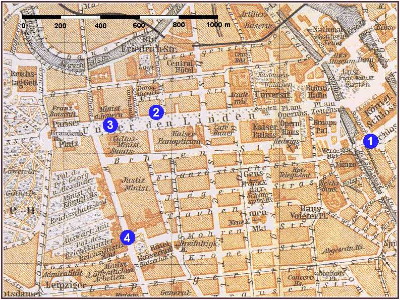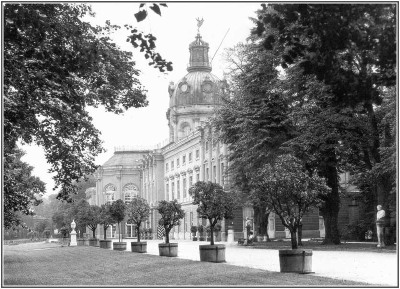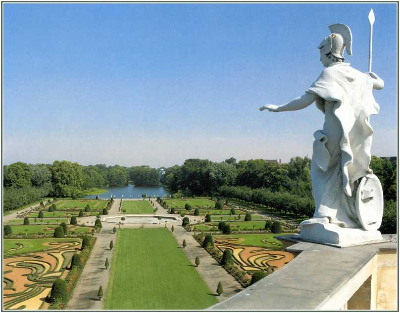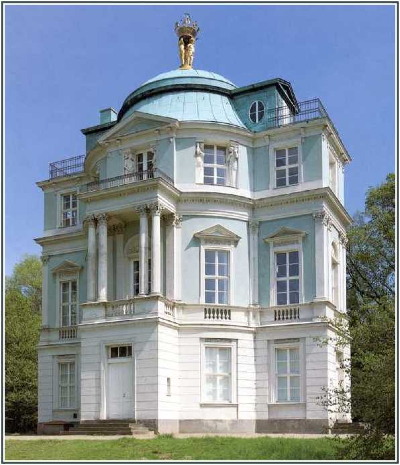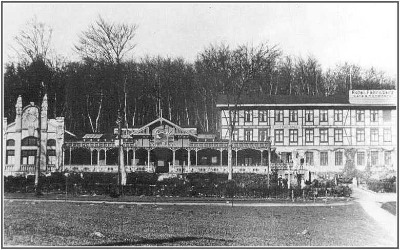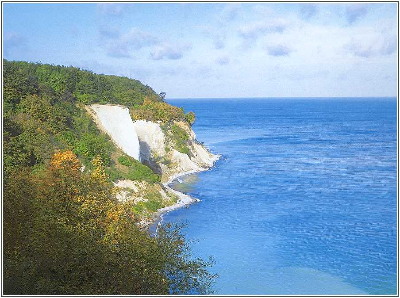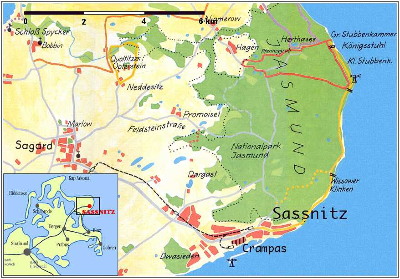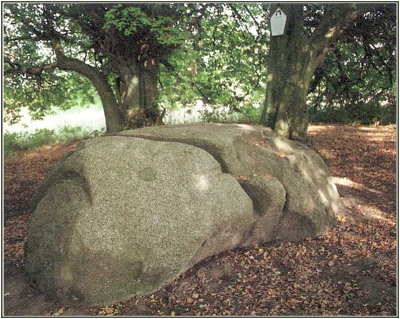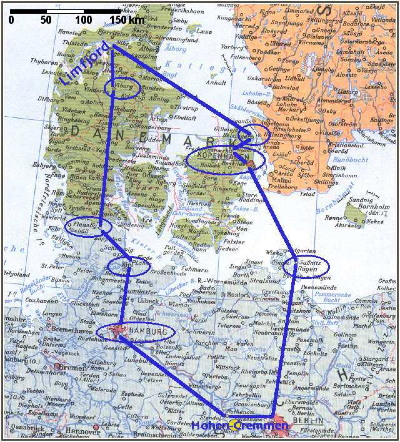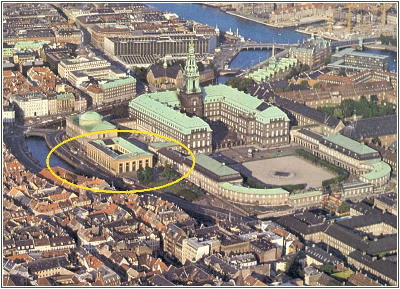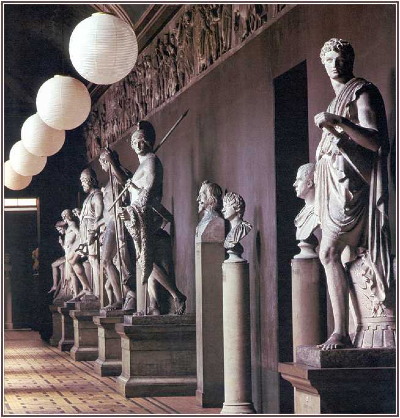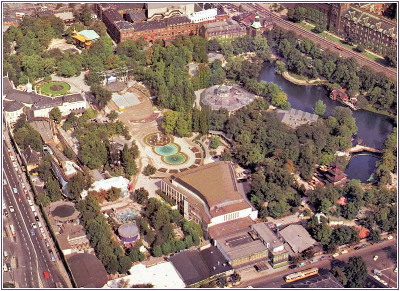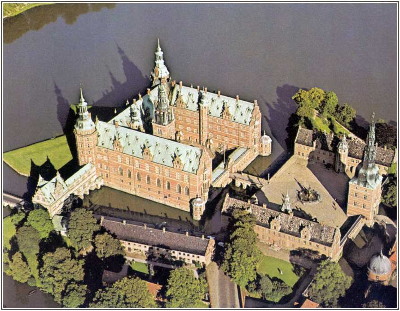Vierundzwanzigstes Kapitel
Man traf sich, wie verabredet, bei Helms, gegenüber dem Roten
Schloß ...
Helms: Schon als Fontanes Roman erschien, gab es das Café Helms nicht mehr. Erst 1883
errichtet (also in dem hier anzunehmenden Handlungsjahr 1880 eigentlich noch nicht vorhanden),
wurde es bereits zehn Jahre später mit der gesamten nach Norden sich anschließenden
Häuserzeile der 'Schlossfreiheit' abgerissen und an dieser Stelle das
Kaiser-Wilhelm-Denkmal errichtet. - Das 'Rote Schloss', so genannt wegen seiner
dem Berliner Schloss nicht unähnlichen Renaissance-Fassade, nur aus Backstein,
war ein 1867 eröffnetes Geschäftshaus in der Werderstraße.
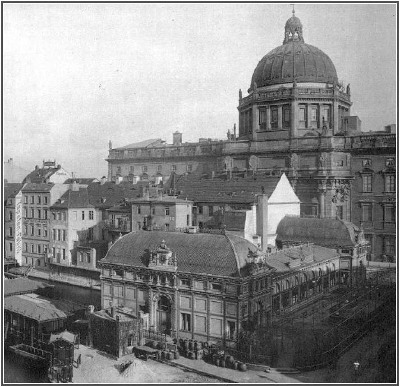 |
|
Blick auf das Café Helms und das Schloss
|
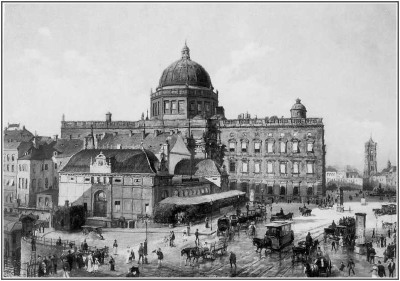 |
|
Albert Kiekebusch: Blick von der Schleusenbrücke zum Berliner
Schloß (1892), davor das Café Helms.
|
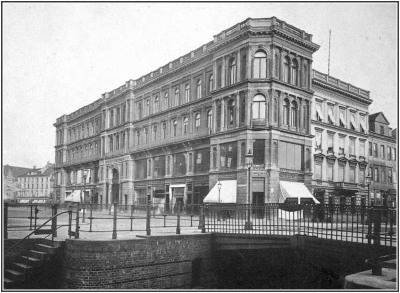 |
|
Das 'Rote Schloss' gegenüber dem Café Helms - an derselben Stelle, nur ein wenig
zurückversetzt, steht heute das vormalige DDR-Staatsratsgebäude mit dem originalen
Schloss-Portal.
|
... aß bei Hiller und war bei guter Zeit wieder zu Haus.
Hiller: Das Restaurant Hiller, Unter den Linden 62, war ein
elegantes kleines Restaurant, das sich von den großen Hotel-Restaurants an
den Linden durch seine Behaglichkeit unterschied. Es wurde 1886 von dem aus Mainz
stammenden Gastwirt Lorenz Adlon (1849-1921) übernommen, der damit in Berlin
Fuß fasste und 1907 am Brandenburger Tor sein dann berühmtes "Hotel Adlon" errichtete.
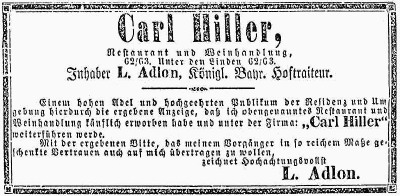 |
|
Eine Anzeige aus der Vossischen Zeitung vom November 1886, als Lorenz Adlon
das Restaurant Hiller übernahm.
|
... am 1. April, begab er sich in das Kanzlerpalais,
um sich einzuschreiben ...
Kanzlerpalais: Zu Bismarcks Geburtstag am 1. April (geboren 1815) lagen in seinem
Amtssitz Gratulationslisten aus, in die sich auch Fontane einzutragen pflegte.
Am 1. April 1887 schreibt er an seinen Sohn Theodor:
Heut', am Bismarckstage, haben wir wie gewöhnlich gratuliert,
aber nur mit drei Karten, darunter zwei weibliche; es gab Zeiten,
wo wir wie ein Clan im Kanzlerpalais auftauchten.
Das Reichskanzlerpalais war ein Barockbau, den sich 1739 Graf von
der Schulenburg hatte errichten lassen. Danach in den Besitz der
Prinzen Radziwill übergegangen, war er von 1878 an der Wohnsitz
des Reichskanzlers - also Bismarcks - in Berlin.
 |
|
Das Reichskanzlerpalais - Wilhelmstraße 76 - in einer
Aufnahme von 1880.
|
... und ging dann aufs Ministerium, um sich da zu melden.
Ministerium: Das Ministerium, in das Innstetten als vormaliger Landrat berufen
worden ist, ist das Innenministerium, sein 'Chef' wäre 1880 Botho
Graf zu Eulenburg (1831-1912) gewesen, der von Bismarck wegen seiner
Nachgiebigkeit bei der Sozialisten-Verfolgung 1881 aber entlassen wurde.
 |
|
Das 1877 neu errichtete preußische Innenministerium Unter den Linden in einer
Aufnahme von 1930.
|
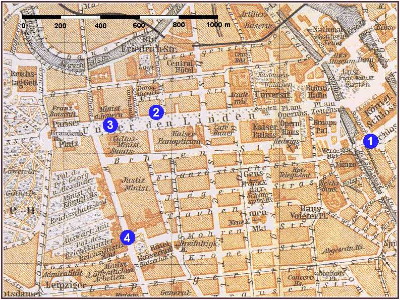 |
|
Die Berliner Innenstadt mit dem Café Helms (1),
dem Restaurant Hiller (2), dem Innenministerium (3) und dem
Reichskanzlerpalais (4).
|
... oder nachmittags einen Spaziergang nach dem Charlottenburger Schloßgarten
machen zu können.
Charlottenburg: Der Spaziergang nach dem Charlottenburger Schlossgarten bedeutet vom Berliner
Tiergarten aus eine Wegstrecke von wenigstens sechs Kilometern, weshalb man für den
Rückweg auch eine Droschke nimmt. -
Der Schlossgarten gehörte zwar zu dem von der Königsfamilie noch bewohnten Areal,
war aber an bestimmten Tagen für Besucher geöffnet.
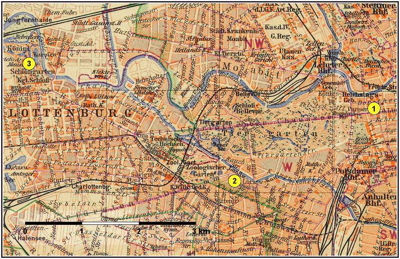 |
|
Der Berliner Westen zwischen dem Brandenburger Tor und Charlottenburg
mit dem Innenministerium (1), der Wohnung der Innstettens in der
Keithstraße (2) und dem Charlottenburger Schloss (3).- Karte von 1904.
|
Effi sah sich, wenn sie die lange Front
zwischen dem Schloß und den Orangeriebäumen auf und
ab schritt, immer wieder die massenhaft dort stehenden römischen
Kaiser an ... und ging dann, Arm in Arm mit ihrem Manne, bis
auf das nach der Spree hin einsam gelegene »Belvedere« zu.
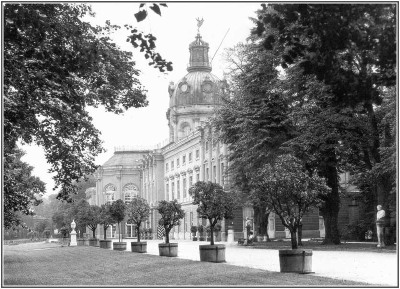 |
|
Die Gartenfront des Charlottenburger Schlosses 1919 in einer Aufnahme
von Max Missmann. (Die Stelen mit den Kaiser-Büsten sind heute nicht
mehr vorhanden.)
|
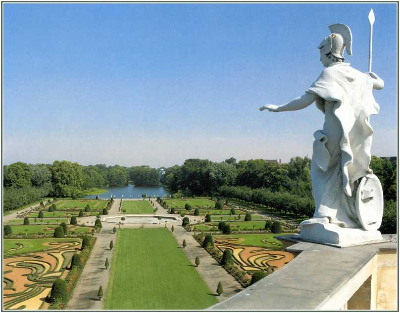 |
|
Der Charlottenburger Schlosspark mit dem Belvedere im Hintergrund
|
"Da drin soll es auch einmal gespukt haben ..."
Belvedere: In dem von Karl Gottfried Langhans 1788 errichteten Belvedere hielt König Friedrich
Wilhelm II., der Mitglied einer Freimaurer-Loge war und allerlei okkulte Neigungen
besaß, spiritistische Sitzungen ab.
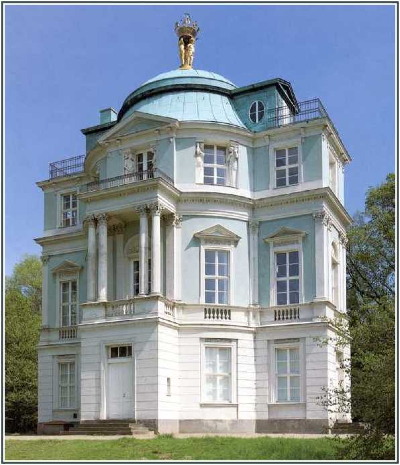 |
|
Das Belvedere im Charlottenburger
Schlosspark.
|
... und am selben Abend noch war man in Saßnitz.
Über dem Gasthaus stand "Hotel Fahrenheit". "Die
Preise hoffentlich nach Réaumur," setzte Innstetten,
als er den Namen las, hinzu ...
Fahrenheit: Das Sassnitzer Hotel hieß eigentlich Fahr(e)nberg, die
Änderung des Namens in Fahrenheit war Fontane nur aus ungenauer
Erinnerung unterlaufen. In einem Brief vom 29. August 1894 an Georg
Friedlaender schreibt er:
Das Saßnitzer Hôtel hieß in meiner Erinnerung 'Fahrenheit' und darauf anspielend,
kommt in meinem neusten Roman - dessen eines Kapitel auf Rügen spielt - ein
kleiner Wortwitz vor, der nun traurig in der Luft schwebt, da das Hôtel Fahrenberg heißt.
Ja, man wird mich in Verdacht haben, daß ich die Umtaufe, um mein Witzelchen anzubringen,
absichtlich vollführt habe. Und das ist das Unangenehmste von der Sache.
Trotz dieses Bedenkens hat er den Namen für die Buchausgabe beibehalten,
wollte auf sein 'Witzelchen' also doch wohl nicht verzichten. Der Danziger Physiker Daniel
Fahrenheit (1686-1736) hatte zum Nullpunkt seiner Quecksilber-Skala die im Winter 1709
in Danzig herrschende Kälte gewählt und den Siedepunkt des Wassers mit der Gradzahl 212 bestimmt.
Daraus ergibt sich gegenüber der Celsius-Skala ein stets deutlich höherer Nennwert für die
gemessene Temperatur. Der Franzose René Antoine Réaumur (1683-1757) wählte hingegen als
Nullpunkt den Gefriermoment des Wassers und legte den Siedepunkt mit 80 Grad fest, so dass
die Nennwerte hier noch unter der Celsius-Skala liegen. - Während die Réaumur-Skala
durch das Celsius-Thermometer ganz verdrängt wurde, wird in der angelsächsischen Welt
und zumal in den USA noch heute nach Fahrenheit gemessen.
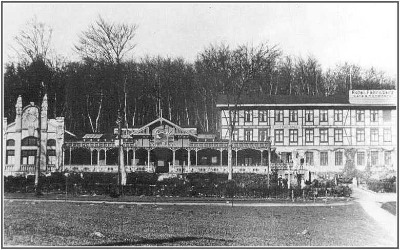 |
|
Das Hotel Fahrnberg in Sassnitz um 1920
|
... und in bester Laune machten beide
noch einen Abendspaziergang an dem Klippenstrande hin und sahen
von einem Felsenvorsprung aus auf die stille, vom Mondschein überzitterte
Bucht.
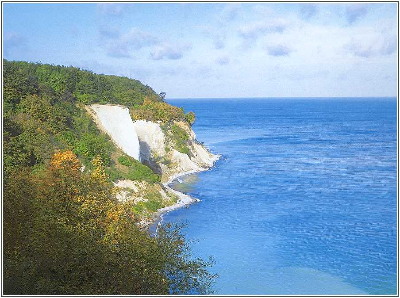 |
|
Die Kreideküste an den Wissower Klinken
|
Effi glaubte, nicht recht gehört zu haben. "Crampas,"
wiederholte sie mit Anstrengung. "Ich habe den Namen als
Ortsnamen nie gehört ..."
Das dicht bei Sassnitz gelegene, 1906 eingemeindete Dorf Crampas (mitunter auch
'Krampas' geschrieben) war damals als die Anlegestelle der Fähren bekannt.
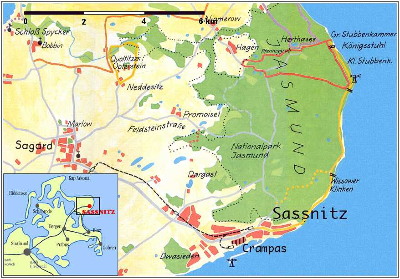 |
|
Sassnitz, Crampas und die Halbinsel Jasmund.
|
... gegen Mittag schon erreichten sie das neben Stubbenkammer gelegene
Gasthaus ... "wir haben vor, zunächst noch
einen Spaziergang zu machen und uns den Herthasee anzusehen."
Stubbenkammer: Die Kreideküste, die hier über 100 Meter hoch
aus der Ostsee aufsteigt, ist der berühmteste Teil von Rügen. An dem oben auf
dem Plateau gelegenen Herthasee soll einst eine germanische Göttin verehrt worden
sein, in deren Dienst auch Menschen geopfert, d.h. ertränkt wurden. In dieselbe
Überlieferung gehören die 'Opfersteine', große Findlinge mit
charakteristischen Rinnen und Mulden, die bei Menschenopfern für die Ableitung
des Blutes gedient haben sollen. Am Herthasee sind zwei solcher Steine zu sehen,
ähnlich dem größten dieser Steine, dem Quoltitzer Opferstein.
Nach heutigen Erkenntnissen hat es jedoch weder den germanischen Götzendienst
noch die Blutopfer gegeben. Die Findlinge stammen aus der Eiszeit, ihre Rinnen
und Mulden sind natürlichen Ursprungs. Schon Fontane notierte bei seinem
Rügen-Besuch 1884 zu der Opferstein-Geschichte: "Alles kolossaler Schwindel".
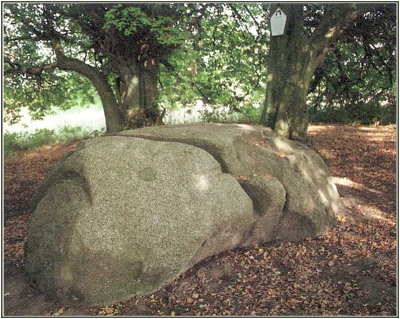 |
|
Der Quoltitzer Opferstein, ein Findling, wie sie kleiner auch am Herthasee
zu finden sind.
|
Und so warteten sie denn das Stettiner Schiff ab und trafen am
dritten Tage in aller Frühe in Kopenhagen ein ...
Kopenhagen: Mit der Weiterfahrt nach Kopenhagen, den Abstechern nach Fredericksborg und
Helsingör, dem Aufenthalt am Limfjord in Jütland und der Rückreise über
Viborg und Flensburg folgt das Ehepaar Innstetten derselben Route, auf der
sich auch Fontane bei seiner Dänemark-Reise im September 1864 bewegt hat. Auch
in Hamburg und Kiel ist er - auf den Spuren des Schleswig-Holstein-Krieges -
1864 gewesen. Die von den Innstettens von Mitte August bis Ende September 1880
abgereiste Strecke beträgt über 1500 km.
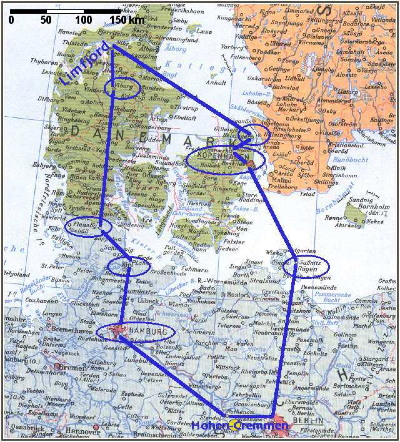 |
|
Die Reiseroute durch Dänemark
|
... wo sie auf Kongens Nytorv Wohnung nahmen.
Kongens Nytorv: 'Königs-Neumarkt', größter Platz von Kopenhagen
mit dem dort seit 1795 bestehende Hotel d'Angleterre. Auch Fontane übernachtete
1864 in diesem Hotel.
 |
|
Das Hotel d'Angleterre am Kongens Nytorv
|
Zwei Stunden später waren sie schon im Thorwaldsen-Museum ...
Thorwaldsen-Museum: Der an seinem Lebensabend nach Kopenhagen zurückgekehrte Bildhauer
Bertel Thorvaldsen (1770-1844) hatte seiner Vaterstadt seinen gesamten Nachlass
vermacht, damit sie für seine Werke dort ein Museum errichtete. Im Hof des 1848
eingeweihten Gebäudes wurde er auch begraben. Gelebt hat er überwiegend
in Rom, wo auch eine größere Zahl seiner Werke steht. Aber auch in Warschau,
Berlin, München und anderen deutschen Städten sind Skulpturen von ihm
zu finden.
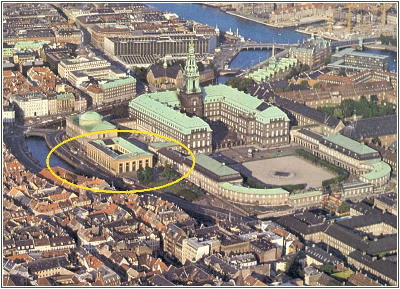 |
|
Das Thorvaldsen-Museum Kopenhagen
|
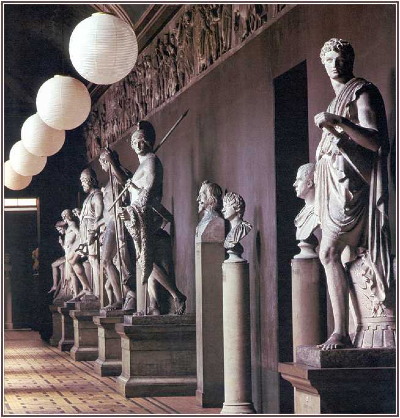 |
|
Eine Skulpturen-Reihe im Thorvaldsen-Museum
|
Der Abend brachte, das Maß des Glücks
voll zu machen, eine Vorstellung im Tivoli-Theater ...
Tivoli: 1843 eröffneter Vergnügungspark im Zentrum von Kopenhagen,
in dem bis heute alle möglichen Unterhaltungs-Veranstaltungen stattfinden.
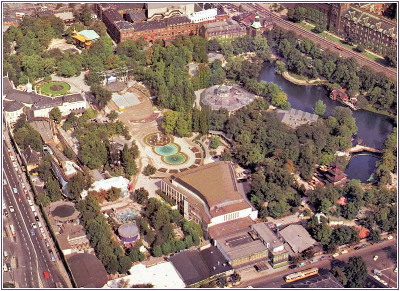 |
|
Im Tivoli-Park in Kopenhagen
|
"... wir bleiben noch ein paar Tage hier in Kopenhagen,
natürlich mit Ausflug nach Frederiksborg und Helsingör ..."
Frederiksborg: Renaissance-Schloss 30 km nördlich von Kopenhagen, das
einst das Krönungsschloss für die dänischen Könige war.
Helsingør: Ort des durch Shakespeares "Hamlet" (1602) berühmt
gewordenen Schlosses Kronborg.
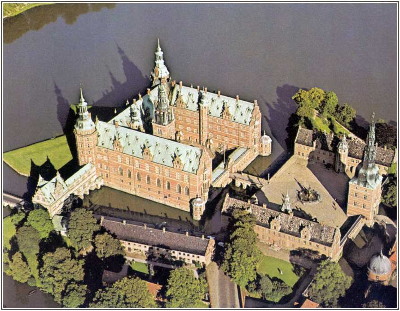 |
|
Schloss Frederiksborg
|
 |
|
Schloss Kronborg
|
Drüben in Jütland fuhren
sie den Limfjord hinauf, bis Schloß Aggerhuus ...
Limfjord: die Verbindung der Nordsee mit dem Kattegat im Norden von Jütland. Aggerhus
ist für diese Gegend ein erfundener Name, doch kommen hier Agger, Aggersborg, Aggersund
und andere solche Namen vor. Fontane hat diese Gegend 1864 ebenso besucht wie dann auch
noch Viborg und Flensburg.