Am 4. Mai 1771.
Die Anbindung des "Werther" an Goethes Wetzlarer Aufenthalt war schon zu
dessen Lebzeiten so selbstverständlich, dass man den Erkenntnisweg, der
zu dieser Anbindung führte, bald gar nicht mehr wahrnahm. Da das Werk
von 1774 bis 1787 anonym erschien, d.h. weder ein Herausgeber sich
nannte noch von einem Werther etwas bekannt war, hätte man dem
Verfasser eigentlich gar nicht so leicht auf die Spur kommen sollen. Tatsächlich
jedoch war der Name Goethes schon nach wenigen Wochen in aller Munde.
Der Grund: der Selbstmord Werthers erinnerte auf das deutlichste an den
damals zwei Jahre zurückliegenden Selbstmord Karl Wilhelm Jerusalems,
und so fand man über dessen Wetzlarer Umfeld schnell heraus, dass nur
der Verfasser des "Götz von Berlichingen" als Autor infrage kam. Im
übrigen verbarg Goethe seine Autorschaft auch nicht. Schon 1775
deckte dann eine "Berichtigung der Geschichte des jungen Werthers", von einem Wetzlarer
verfasst, das tatsächliche Geschehen mit den Anteilen Goethes,
der Kestners und Jerusalems (hier allerdings 'Werther' genannt)
weitgehend auf und zog bald auch den ersten 'Werther-Tourismus' nach Wetzlar
nach sich.
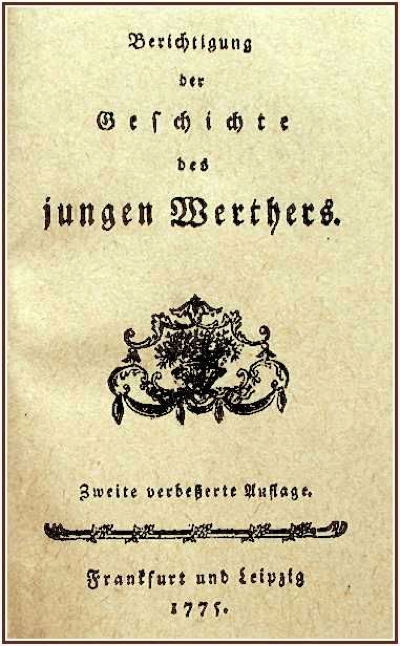 |
|
Deckblatt der ersten Broschüre, die die biographischen
Hintergründe des "Werther" - schon weitgehend richtig -
beleuchtet. (Städtische Sammlungen Wetzlar)
|
Goethes eigene Ausführungen in "Dichtung und Wahrheit" (1813) vervollständigten
das Bild, und die Goethe-Philologie des 19. Jahrhunderts hat auch noch die geringsten Spuren
seiner Wetzlarer Erlebnisse in dem Roman nachgewiesen.
~~~~~~~~~~~~
Goethe kam Mitte Mai 1772 nach Wetzlar (zur Vorverlegung der Werther-Handlung
auf das Jahr 1771 siehe unter
GESTALTUNG).
Nach seinem Studium in Leipzig und Straßburg hatte er bei seinem Vater in
Frankfurt am Main eine Art praktischer Rechtsausbildung begonnen und sollte als
Praktikant am Reichskammergericht in Wetzlar weitere Erfahrungen sammeln. Dass
das wirklich der Fall war, ist allerdings zweifelhaft. Dieses Gericht, hauptsächlich
mit Erb- und Gebietsstreitigkeiten unter den deutschen Territorien befasst, wurde
damals gerade inspiziert und neu geordnet und ging bereits vier Wochen nach Goethes
Ankunft in die Ferien. Für den Roman spielt es auch nur insofern eine Rolle,
als bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die
Werther in der 'Stadt' und später in den Diensten des Grafen C*** vorfindet,
den Wetzlarer Verhältnissen nachgebildet sind. Wetzlar selbst ist
in dem Roman eigentlich nicht zu identifizieren, ja nicht einmal ein Land
oder eine Landschaft sind zu erkennen. Da Goethe bei seinen Schilderungen
aber natürlich Wetzlar vor Augen gehabt hat, ist es richtig, sich die
Werther-Handlung vor diesem Hintergrund vorzustellen.
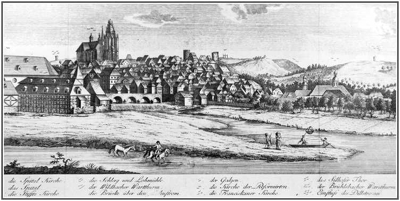 |
|
"Die Stadt ist selbst unangenehm..." - Wetzlar aus westlicher
Richtung, vorn die Einmündung der Dill in die Lahn. Stich von 1802.
(Stadtarchiv Wetzlar)
|
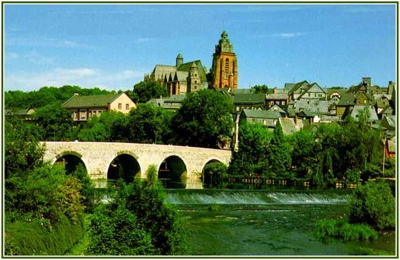 |
|
Der Blick auf Wetzlar heute. Vom besseren Zustand der Häuser abgesehen,
dürfte der Eindruck zur Goethezeit ähnlich gewesen sein.
|
Die Erfahrung der Rivalität zweier Schwestern, die Werther als Grund für
seinen Weggang aus der Heimatstadt angibt, hatte Goethe ebenfalls gemacht,
nicht allerdings in Frankfurt, sondern in Straßburg. Hier hatte er 1770
privaten Tanzunterricht genommen und zwischen den beiden Töchtern seines
Tanzlehrers gestanden, von denen ihm die jüngere Emilie gefiel, während
sich die ältere Lucinde in ihn verliebte. Er musste deshalb den Unterricht
vorzeitig beenden. (Dichtung und Wahrheit, Ende des 9. Buches).
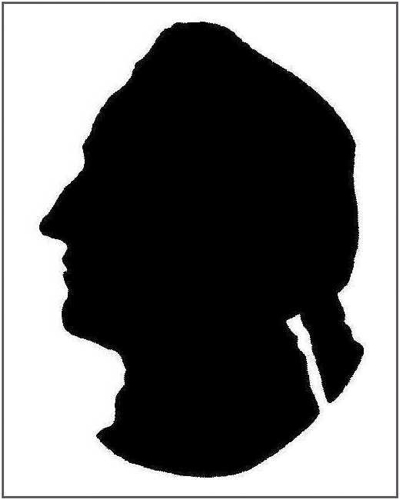 |
|
Silhouette Goethes, Ende 1772 an Kestner gesandt. (Aus der 'Werther'-Ausgabe
von G. von Branca. Weimar 1922.)
|
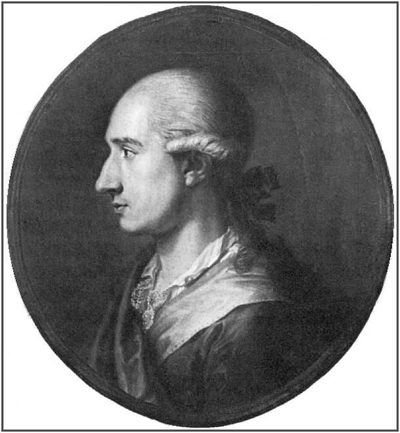 |
|
Goethe 1773. Miniatur-Ölbild von J.D. Bager.
(Heinrich Gloël: Goethes Wetzlarer Zeit. Berlin 1911. Nachdruck Wetzlar 1999.)
|
Wie Werther hatte auch Goethe eine Tante (Großtante), die Hofrätin
Lange, in Wetzlar und nahm mit ihr und ihren drei Kindern, die in
seinem Alter waren, bald nach seiner Ankunft Verbindung auf.
Wahrscheinlich vermittelten sie ihm auch die beiden Zimmer, die
er im Haus Kornmarkt 7, dem ihren gerade gegenüber, bezog.
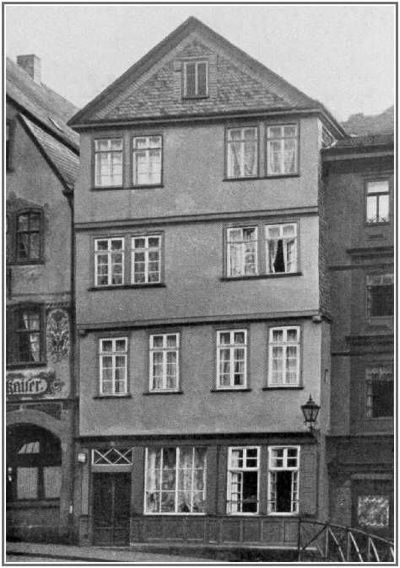 |
|
Das Haus Kornmarkt 7 in einer Aufnahme von 1910. Das oberste Stockwerk
ist erst im 19. Jahrhundert aufgesetzt worden. (Stadtarchiv Wetzlar)
|
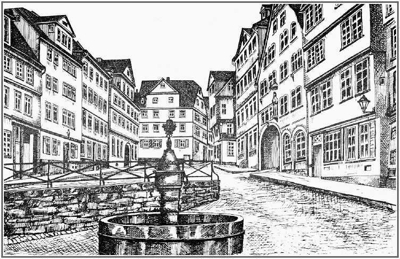 |
|
Der Kornmarkt - rechts das Haus, in dem Goethe, links das Haus,
in dem seine Großtante wohnte. (Stadtarchiv Wetzlar)
|
Einen Garten mietete oder pachtete Goethe in Wetzlar jedoch nicht.
Der Garten des verstorbenen Grafen von M., auf einem Hügel gelegen,
von dem aus man an der Stadt vorbei das Lahntal überblicken kann,
war für ihn der Garten der sogenannten Meckelsburg. Auf dem Lahnberg
gelegen, gehörte er vomals dem Kammergerichts-Beamten Meckel und
wurde nach dessen Tod ein Ausflugslokal. Nach einem Bericht von 1779
(schon damals reiste man auf den Spuren Werthers!) konnte man
dort "zu aller Zeit Kaffee, Wein pp. haben, und das Billard ist den
ganzen Winter geheizt."
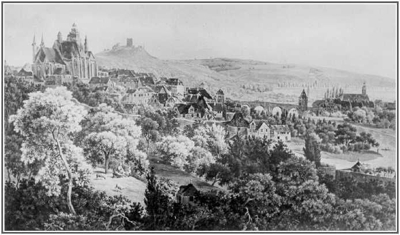 |
|
Blick von der Meckelsburg auf Wetzlar um 1800. (Stadtarchiv Wetzlar)
|





