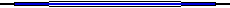Erstes Kapitel
 Alte vergilbte Blätter liegen vor mir ... Heute am vierzehnten März 1611 ritt ich von meinem Sitze am Bielersee hinüber
nach Courtion ...
Alte vergilbte Blätter liegen vor mir ... Heute am vierzehnten März 1611 ritt ich von meinem Sitze am Bielersee hinüber
nach Courtion ...
Mit dem Vorspann - einer Herausgeber-Erklärung - und der exakten Festlegung der Handlung nach Zeit und Ort gibt das "Amulett" sofort
zu erkennen, dass es sich um eine 'realistische' Erzählung handelt. Ein Kenner historischer Lebensverhältnisse hätte sich
zwar wundern können, dass der 1611 ans Werk gegangene Hans von Schadau schon auf einen Schreibtisch-Kalender gesehen hat,
bevor er seine frisch angeschnittene Gänsefeder zum Schreiben ansetzte, d.h. er hätte die Herausgeber-Erklärung
als Herausgeber-Fiktion durchschauen können,
aber das trat keineswegs überall ein. In einer Rezension der Wiener NEUEN FREIEN PRESSE vom 13. März 1874 heißt es:
Wie viele von den Tugenden dieser Novelle schon in jenen 'alten, vergilbten Aufzeichnungen' enthalten sind, die der Dichter benutzt
zu haben vorgibt, und ob seine Arbeit nur wirklich darin besteht, sie 'in die Sprache unserer Zeit übertragen zu haben', das wissen
wir allerdings nicht; aber auch wenn wir diesen bescheidenen Fall gelten lassen, bleibt es des Autors Verdienst, einen glücklichen Fund mit
glücklichem Verständnis verwertet zu haben.

Die Mehrzahl der Leser hat je länger je mehr aber natürlich Conrad Ferdinand Meyer als den Verfasser wahrgenommen und
deshalb auch das in der Novelle Mitgeteilte als seine Sicht der
Dinge, als sein Verständnis vom Leben aufgefasst.
Erst in jüngerer Zeit ist wiederum das Gegenteil eingetreten und man hat zwischen dem Autor Meyer und dem von ihm erfundenen Erzähler
Hans von Schadau eine scharfe Trennlinie gezogen. Insofern Schadaus "bornierte Engstirnigkeit" von vornherein offengelegt sei, so das
Argument (nämlich dass er in derselben Lage wiederum so handeln würde wie früher), könne er unmöglich
die Meinung Meyers vertreten, der aus seinen Erfahrungen gelernt haben würde und sowieso immer für religiöse Toleranz
eingetreten sei. Vielmehr bediene sich Meyer von Anfang bis Ende einer gegen Schadau gerichteten "ironischen Erzählperspektive",
von der er sich eine "emanzipatorische Wirkung beim Leser" verspreche.

Alles also Ironie? Natürlich nicht, und dies nicht nur deshalb nicht, weil es dann die Leser ein ganzes Jahrhundert lang nicht gemerkt hätten.
Tatsächlich enthält die Novelle nicht einen einzigen Hinweis darauf, dass wir es in Schadau mit einem uneinsichtigen, wahrnehmungsgestörten
oder sonst wie unzuverlässigen Erzähler zu tun haben sollen. Das Ironie-Argument ist - wie immer in solchen Fällen - nur der hilflose Versuch,
einen Autor, dessen Können man bewundert, dessen Ansichten man aber nicht erträgt, auf die eigene Seite zu ziehen.
Das bedeutet nicht, dass Schadau sich des von ihm vertretenen Prädestinations-Glaubens stets sicher ist. Es gibt etliche Situationen, in
denen von seinem behaupteten Gleichmut dem ihm bestimmten Schicksal gegenüber nichts übrig bleibt, und auch sein Urteil über
das ihm Widerfahrene schwankt. Das jedoch sind Widersprüche, die ihm nicht erzählerisch verordnet werden, damit wir auf ihn herabsehen,
sondern die seine Menschlichkeit ausmachen, so wie sie - aller Wahrscheinlichkeit nach - auch Meyers Menschlichkeit ausgemacht haben. Das
"Amulett" ist also keine Geschichte um zwei 'beschränkte Fanatiker' - Schadau und Boccard -, an denen wir nach Meyers Intention
erfahren sollen, wohin religiöser Fanatismus führt,
sondern es will uns - auf dem Hintergrund der Religionskriege des 16. Jahrhunderts - demonstrieren, wie unbegreiflich das dem Menschen
zudiktierte Schicksal von Fall zu Fall sein kann.
Die nachfolgende Kommentierung wird besonders auf die Stellen achten, die mit dem Prädestinations-Gedanken und Schadaus
Verständnis davon zu tun haben, weil dies sicherlich auch der didaktisch interessanteste Aspekt ist.
~~~~~~~~~~~~
 Wie ich ihn alles hastig durcheinanderwerfen sah, erhob ich mich unwillkürlich, als müsst' ich ihm helfen.
Wie ich ihn alles hastig durcheinanderwerfen sah, erhob ich mich unwillkürlich, als müsst' ich ihm helfen.
Bereits der Anstoß, seine Erinnerungen niederzuschreiben, ergibt sich für Schadau gleichsam schicksalhaft: Er steht 'unwillkürlich' auf
und erblickt dabei die Gegenstände, die sein Leben mit dem Boccards verbunden haben. Allerdings, so würde man in psychologischer
Sicht hinzufügen, könnte ihn dieser Anblick schwerlich zu einer tage- oder wochenlangen Niederschrift seiner
Erlebnisse veranlasst haben, wenn ihm die ganze Geschichte nicht sowieso 'auf der Seele gelegen' hätte.
~~~~~~~~~~~~
 In dem Fache lagen nebeneinander zwei seltsame, beide mir nur zu wohl bekannte Gegenstände: ein durchlöcherter Filzhut, den
einst eine Kugel durchbohrt hatte, und ein großes rundes Medaillon ...
In dem Fache lagen nebeneinander zwei seltsame, beide mir nur zu wohl bekannte Gegenstände: ein durchlöcherter Filzhut, den
einst eine Kugel durchbohrt hatte, und ein großes rundes Medaillon ...
Die beiden Gegenstände sind auch für den Leser das 'erregende Moment', weil sie einerseits einen tödlichen Schuss andeuten und
andererseits das 'Medaillon' eine Verbindung zu dem Titel "Das Amulett" herstellt, ihm also eine zentrale Bedeutung zuzukommen scheint.
Wie diese Gegenstände in den Besitz des alten Boccard gekommen sind, bleibt ungesagt und wird auch später nicht aufgeklärt. Als der
junge Wilhelm Boccard in Paris von einer Kugel in den Kopf getroffen wird (siehe
9. KAPITEL), findet
sich weder die Mitnahme seines Hutes erwähnt noch die des Amuletts.
~~~~~~~~~~~~
 Ich habe ihn in den Tod gezogen. Und doch, sosehr mich dies drückt, kann ich es nicht bereuen und
müsste wohl heute im gleichen Falle wieder so handeln ...
Ich habe ihn in den Tod gezogen. Und doch, sosehr mich dies drückt, kann ich es nicht bereuen und
müsste wohl heute im gleichen Falle wieder so handeln ...
Der Aussage Schadaus, er habe Boccard 'in den Tod gezogen', wird von denjenigen, die ihm Unbelehrbarkeit vorwerfen (weil er 'wieder so' handeln
würde), eine hohe Bedeutung beigemessen. Dabei trifft sie nur sehr bedingt zu. Schadau verlangt nach der Bartholomäusnacht von Boccard
keineswegs dessen Unterstützung oder Begleitung, sondern lediglich seine Freilassung. Boccard beteiligt sich also freiwillig an der Rettungsaktion
für Gasparde, weshalb diese später auch richtig sagt: "Für mich ist er gestorben."
(siehe
10. KAPITEL).
Schadaus Selbstanklage trifft mithin nur in dem sehr weitläufigen Sinne zu, dass Boccard umgekommen ist, weil er Schadau kennengelernt hat und
sein Freund geworden ist. Nennt man das Schuld? Eher könnte man Schadau vorwerfen, er nehme sich zu wichtig, weil er Boccards Leben nur als
ein Zubehör des seinen wahrnimmt und ihm nicht auch ein eigenes Schicksal zugesteht. Dies freilich ist die Schwachstelle
jedes individuellen Schicksals-Verständnisses und
Schadau kaum besonders anzulasten.
Zweites Kapitel
 Meine Denkkraft übte sich mit Genuss an der herben Konsequenz der calvinistischen Lehre ... aber mein Herz gehörte sonder
Vorbehalt dem Oheim.
Meine Denkkraft übte sich mit Genuss an der herben Konsequenz der calvinistischen Lehre ... aber mein Herz gehörte sonder
Vorbehalt dem Oheim.
Mit diesem Bekenntnis räumt Schadau ein, dass er keineswegs ein dogmatischer Anhänger der Prädestinationslehre ist, sondern
mehr nur ein Denkmodell in ihr sieht. Ihn als bornierten Eiferer zu verstehen, wie es einige jüngere Auslegungen tun, lässt sich schon mit dieser
Aussage nicht vereinbaren. Richtiger spricht eine Arbeit von 1972 für Schadau von einer 'Religion des Herzens', die ihn in allen entscheidenden Situationen
gerade undogmatisch handeln lässt.
 Ich nährte seit Langem den Wunsch, einen wilden jungen Hengst, den ich in Biel gesehen, einen prächtigen Falben, zu besitzen ...
Ich nährte seit Langem den Wunsch, einen wilden jungen Hengst, den ich in Biel gesehen, einen prächtigen Falben, zu besitzen ...
Schadaus Wunsch nach dem Falben wird erfüllt, wie sich anschließend herausstellt, er reitet auf diesem Pferd nach Paris. Eben dieses Pferd
sorgt dann aber auch dafür, dass er auf dem Weg nach Melun umkehren muss und dadurch die ihm 'vorbestimmte' Gasparde kennenlernen kann.
Besonders betont wird dieser Kausalzusammenhang allerdings nicht, zumal von dem Pferd nach Schadaus Eintreffen in Paris nicht mehr die Rede ist.
~~~~~~~~~~~~
 Entschlossen den Übeltäter festzunehmen und der Gerechtigkeit zu überliefern, erhob ich doch unwillkürlich das
Schreiben in der Weise, dass ihm das große, rote Siegel ... sichtbar wurde ...
Entschlossen den Übeltäter festzunehmen und der Gerechtigkeit zu überliefern, erhob ich doch unwillkürlich das
Schreiben in der Weise, dass ihm das große, rote Siegel ... sichtbar wurde ...
Durch das 'unwillkürlich' erhobene Schreiben, das dem verfolgten Böhmen die Flucht ermöglicht, wird ein erster starker Beweis für
Schadaus Idee der Vorherbestimmtheit seines Lebens - den Prädestinationsgedanken - vorbereitet: Der Böhme wird Schadau, als er in
Paris mit Gasparde in Lebensgefahr ist, als Gegenleistung ebenfalls die Flucht ermöglichen. Dabei ist entscheidend, dass Schadau nicht aus
Überzeugung, sondern unwillkürlich handelt, sich also nicht etwa überlegt, dass er dem Böhmen seine Fechtkünste verdankt und
deshalb Gnade vor Recht ergehen lassen könnte. Er wird zum Handelnden (und sein Handeln lässt den Böhmen beinahe wunderbar
auch entkommen), weil es ihm so bestimmt ist.
~~~~~~~~~~~~
 Seine Flamme, ein lothringisches Fräulein, hatte er vor den Augen seiner katholischen Todfeinde, der Guisen, aus ihrer Stadt Nancy
weggeführt ... Etwas Derartiges wünschte ich mir vorbestimmt.
Seine Flamme, ein lothringisches Fräulein, hatte er vor den Augen seiner katholischen Todfeinde, der Guisen, aus ihrer Stadt Nancy
weggeführt ... Etwas Derartiges wünschte ich mir vorbestimmt.
Dieser Wunsch geht für Schadau gleich zweifach in Erfüllung: Nicht nur wird er ebenfalls seine 'Flamme' vor den Augen seiner Feinde, der
Katholiken, aus Paris entführen, sondern es wird sogar die Tochter seines Helden Dandelot sein.
Drittes Kapitel
 Plötzlich fuhr ein blendender und krachender Blitzstrahl wenige Schritte vor mir in die Erde. Der Falbe stieg, drehte sich und
jagte in wilden Sprüngen gegen das Dorf zurück ...
Plötzlich fuhr ein blendender und krachender Blitzstrahl wenige Schritte vor mir in die Erde. Der Falbe stieg, drehte sich und
jagte in wilden Sprüngen gegen das Dorf zurück ...
Der Blitz schlägt wie ein Gottesbefehl vor Schadau ein, so dass er, selbst wenn er wollte, den Weg nach Melun nicht fortsetzen kann. So
muss er Gasparde wie Boccard kennenlernen, und
selbst Boccard nennt es später eine glückliche Fügung, dass den Reiter "Blitz und Donner in die drei Lilien zurückjagten, sonst
wären wir uns fremd geblieben" (siehe
5. KAPITEL).
~~~~~~~~~~~~
 Während Boccard seine innere Genugtuung zu verbergen suchte, musterte ich eilig meine Gegengründe; aber ich wusste
in diesem Augenblicke nichts Triftiges zu antworten ...
Während Boccard seine innere Genugtuung zu verbergen suchte, musterte ich eilig meine Gegengründe; aber ich wusste
in diesem Augenblicke nichts Triftiges zu antworten ...
Es kann offen bleiben, ob Meyer selbst diesem logischen Dilemma gegenüber nicht weiter weiß - von einem der 'vielen Zeichen für seine
Unklarheit in Weltanschauungsfragen' spricht Zäch -
oder ob nur Schadau hier nichts mehr einfällt. Tatsache ist, dass auch die theologisch-dogmatische Diskussion für diesen Widerspruch nie zu
einem logisch befriedigenden Schluss gekommen ist. Für Schadau aber bedeutet das Verstummen an dieser Stelle, zumal er sich auch
nachträglich seiner Argumente nicht vergewissert, dass er nicht mit letzter Bestimmtheit an die Prädestination glaubt.
~~~~~~~~~~~~
 Mit diesen Worten zog er eine seidene Schnur, die er um den Hals trug und an der ein Medaillon hing, aus dem Wams hervor
und küsste es mit Inbrunst.
Mit diesen Worten zog er eine seidene Schnur, die er um den Hals trug und an der ein Medaillon hing, aus dem Wams hervor
und küsste es mit Inbrunst.
Für den calvinistisch erzogenen Schadau sollte das Tragen eines solchen Medaillons der reine Götzendienst sein und ihm den Verkehr
mit Boccard unmöglich machen. Stattdessen jedoch reicht er ihm die Hand - ein weiteres Zeichen dafür, dass von religiöser Intoleranz
bei ihm - und ebenso bei Boccard - nicht die Rede sein kann.
~~~~~~~~~~~~
 Während ich diese Worte sprach, begann Fräulein Gasparde zu meinem Erstaunen erst leise zu erröten, ... bis sie mit Rot
wie übergossen war.
Während ich diese Worte sprach, begann Fräulein Gasparde zu meinem Erstaunen erst leise zu erröten, ... bis sie mit Rot
wie übergossen war.
Gasparde kann das Lob der Tugend Dandelots nur mit großer Verlegenheit anhören, weiß sie doch, was Schadau
erst in Paris erfahren wird, dass sie das Kind aus einer außerehelichen Beziehung dieses Mannes ist
(siehe
4. Kapitel).
Viertes Kapitel
 Dass ich Gaspardes Liebe gewinnen könne, schien mir nicht unmöglich, Schicksal, dass ich es musste, und Glück, mein
Leben dafür einzusetzen.
Dass ich Gaspardes Liebe gewinnen könne, schien mir nicht unmöglich, Schicksal, dass ich es musste, und Glück, mein
Leben dafür einzusetzen.
Das Pathos dieses Bekenntnisses passt wenig zu einem Anhänger der Prädestinationslehre, der als solcher eigentlich nur hätte
wünschen oder hoffen können, dass ihm das Schicksal Gasparde zur Frau bestimmt habe. Erst recht aber dürfte Schadau von seiner
Bereitschaft, sein Leben für sie einzusetzen, nicht sprechen, da er nach calvinistischen Grundsätzen zwar für seinen Glauben, nicht
aber für eine Frau zu sterben bereit sein dürfte.
Hinter dieser Entschlossenheit steht auch wohl weniger er als der Autor selbst. Zur Zeit der Ausformulierung der Novelle, Anfang
1873, trug Meyer sich mit dem Gedanken, um die ihm schon länger bekannte Luise Ziegler zu werben, und musste sich besonders seiner Schwester
gegenüber, der er die Novelle diktierte, dabei stark machen (siehe unter
ENTSTEHUNG). Eben deshalb
wohl blieb ihr dieser Moment des Diktates im Gedächtnis. In einem Zeugnis von ihr heißt es:
"Diesen zusammenfassenden Schlußstein des Kapitels hat der Dichter mit Absicht so scharf geschliffen. Er diktierte an jenem
Vormittag in Meilen gemütlich, die Zigarre in der Hand, sein Zimmer auf- und niederschreitend. Dann stand er still, rezitierte die Periode mit
besonderer Betonung und sagte: So muß dies Kapitel schließen."
Fünftes Kapitel
 "Boccard", sagte ich, "betrübe dich nicht. Alles ist vorherbestimmt. Ist meine Todesstunde auf morgen
gestellt, so bedarf es nicht der Klinge des Grafen, um meinen Lebensfaden zu zerschneiden."
"Boccard", sagte ich, "betrübe dich nicht. Alles ist vorherbestimmt. Ist meine Todesstunde auf morgen
gestellt, so bedarf es nicht der Klinge des Grafen, um meinen Lebensfaden zu zerschneiden."
Die Schicksalsergebenheit Schadaus in dieser Situation scheint ganz und gar dem Prädestinations-Glauben zu entsprechen, bewegt
sich aus christlicher Sicht aber an der Grenze zur Gotteslästerung. Wegen einer solchen Lappalie, wie sie der Spott des Grafen
Guiche ist, einen Kampf auf Leben und Tod anzuzetteln, hat mit christlicher Gottergebenheit nicht zu tun. Hier würde vielmehr die Bergpredigt gelten
mit dem Wort: "Wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar" (Matthäus Kapitel 5, Vers 39).
Dass sich Schadau und Boccard hinsichtlich der Notwendigkeit des Duells völlig einig sind, zeigt das undogmatische oder verweltlichte Christentum gleich
beider an.
Sechstes Kapitel
 Sein Aberglaube war verwerflich, aber seine Freundestreue hatte mir das Leben gerettet.
Sein Aberglaube war verwerflich, aber seine Freundestreue hatte mir das Leben gerettet.
In offenem Widerspruch zu der Tags zuvor geäußerten Meinung, seine Todesstunde sei ihm entweder für diesen
Tag vorbestimmt oder nicht vorbestimmt, akzeptiert Schadau jetzt, dass Boccards Medaillon ihm das Leben gerettet habe - nicht
selbstverständlich wegen der Mutter Gottes von Einsiedeln, sondern wegen des Metalls.
Psychologisch argumentierend ließe sich dieser Widerspruch natürlich auflösen: Schadau hätte sich dann mit seinem Vertrauen auf
die Vorherbestimmtheit seines Todes nur beruhigt und ist nach seinem Davonkommen demütig genug, nicht einfach zu sagen,
Lebensgefahr habe nicht bestanden. So oder so zeigt auch diese Stelle, dass er mit der Prädestinationsidee recht undogmatisch umgeht.
~~~~~~~~~~~~
 Die seltsamen Umstände, die mich gerettet hatten und die ich Gasparde nicht mitteilen konnte, ohne ihr calvinistisches Gefühl
schwer zu verletzen, verwirrten mein Gewissen ...
Die seltsamen Umstände, die mich gerettet hatten und die ich Gasparde nicht mitteilen konnte, ohne ihr calvinistisches Gefühl
schwer zu verletzen, verwirrten mein Gewissen ...
Dieser Einschätzung zufolge wäre Gasparde mehr darüber entsetzt, dass er bei dem Duell ein Marienbild getragen hat, als
dass er ohne dieses Bild tot wäre und der ihr nachstellende Graf Guiche noch lebte. Mit anderen Worten: sie würde nur schwer
darüber hinwegkommen, dass er - wie unwissentlich immer - einem Götzenbild sein Leben verdankte. Wenn irgendwo im 'Amulett' ein
dogmatischer calvinistischer Standpunkt angedeutet ist, dann hier.
Achtes Kapitel
 "Schwester", fragte sie aus dem Flusse, "weißt vielleicht du, warum sie sich morden? Sie werfen mir Leichnam
auf Leichnam in mein strömendes Bett und ich bin schmierig von Blut. Pfui, pfui! Machen vielleicht die Bettler, die ich abends ihre
Lumpen in meinem Wasser waschen sehe, den Reichen den Garaus?" - "Nein, sie morden sich, weil sie nicht einig sind über
den richtigen Weg zur Seligkeit." Und ihr kaltes Antlitz verzog sich zum Hohn, als belache sie eine ungeheure Dummheit ...
"Schwester", fragte sie aus dem Flusse, "weißt vielleicht du, warum sie sich morden? Sie werfen mir Leichnam
auf Leichnam in mein strömendes Bett und ich bin schmierig von Blut. Pfui, pfui! Machen vielleicht die Bettler, die ich abends ihre
Lumpen in meinem Wasser waschen sehe, den Reichen den Garaus?" - "Nein, sie morden sich, weil sie nicht einig sind über
den richtigen Weg zur Seligkeit." Und ihr kaltes Antlitz verzog sich zum Hohn, als belache sie eine ungeheure Dummheit ...
Mit diesem Traum oder dieser Vision sollte Schadau von jedem Glaubensdogmatismus, soweit er ihm überhaupt unterlag, geheilt sein.
Andernfalls dürfte er davon gar nicht sprechen oder könnte es nur mit schlechtem Gewissen tun. Da nichts dergleichen zu erkennen ist, hat er
sich die liberale Religiosität seines Onkels - jetzt jedenfalls im Alter - endgültig zu eigen gemacht
(siehe
2. KAPITEL).
Konzipiert hat Conrad Ferdinand Meyer diese Vision allerdings in einem anderen Zusammenhang, nämlich den Aufständen der Pariser
Commune Anfang 1871. Dass 'den Reichen' der Garaus gemacht wird, ist diesem historischen Hintergrund entnommen, auch wenn es in dem 1871
verfassten Gedicht "Die Karyatide" nicht ausgesprochen ist:
|
Die Karyatide
Im Hof des Louvre trägt ein Weib
Die Zinne mit dem Marmorhaupt,
Mit einem allerliebsten Haupt.
Als Meister Goujon sie geformt
In feinen Linien, überschlank,
Und stehend auf dem Baugerüst
Die letzte Locke meißelte,
Erschoß den Meister hinterrücks
(Am Tag der Saint-Barthelemy)
Ein überzeugter Katholik.
Vorstürzend überflutet' er
Den feinen Busen ganz mit Blut,
Dann sank er rücklings in den Hof.
Die Marmormagd entschlummerte
Und schlief dreihundert Jahre lang,
Ein Feuerschein erwärmte sie
(Am Tag, da die Kommüne focht).
Sie gähnt' und blickte rings sich um:
Wo bin ich denn? In welcher Stadt?
Sie morden sich. Es ist Paris.
|
Als Meyer erfuhr, dass der Historiker und Schriftsteller Felix Dahn bei grundsätzlichem Lob über das "Amulett" in der Irrealität
des Fluss-Gespräches einen Bruch sah, stimmte er zu:
Dahn hat Recht mit der weggewünschten Stelle, aber es war mir ein Bedürfniß, meinen persönlichen
Abscheu und Ekel, auch mit Durchbrechung der Harmonie, in diesem im XVI. Jahrhundert überhaupt unmöglichen Traum auszusprechen.
Für den Leser hat das überraschend Fremde dieser Szene allerdings noch einen zusätzlichen Effekt: man behält sie
besonders gut im Gedächtnis. Und wirkt sie nicht sogar - als eine jederzeit und sogar heute vorstellbare - 'realer' als das historische
Theaterstück, das um sie herum aufgeführt wird?
Neuntes Kapitel
 Boccard schwankte, griff mit unsicherer Hand nach dem Medaillon, riss es hervor, drückte es an die erblassenden Lippen und sank
nieder.
Boccard schwankte, griff mit unsicherer Hand nach dem Medaillon, riss es hervor, drückte es an die erblassenden Lippen und sank
nieder.
Es wirkt wie ein Hohn auf den Bilderglauben, dass das Medaillon zwar den ungläubigen Schadau schützt, den gläubigen Boccard aber
im Stich lässt. Hinsichtlich der Gläubigkeit Boccards könnte man allerdings auch eine andere Lehre ziehen:
dass der Beistand des Himmels nicht zu erzwingen ist. Boccard in seinem restlosen Vertrauen auf die Mutter Gottes von Einsiedeln muss erfahren, dass
er über deren Schutz nicht verfügt. Dass er das Medaillon sterbend noch an die Lippen drückt (anstatt es enttäuscht von sich zu
werfen), könnte man als Ausdruck dieser Einsicht verstehen.
~~~~~~~~~~~~
 Der erste Blick überzeugte mich, dass ich ihn verloren hatte, der zweite, nach dem Fenster gerichtete, dass ihn der Tod aus meinem
Reiterpistol getroffen, welches Gaspardes Hand entfallen war ...
Der erste Blick überzeugte mich, dass ich ihn verloren hatte, der zweite, nach dem Fenster gerichtete, dass ihn der Tod aus meinem
Reiterpistol getroffen, welches Gaspardes Hand entfallen war ...
Die für Schadau bitterste Wahrnehmung ist, dass Boccard mit seiner Pistole
getötet wird, während umgekehrt dessen Medaillon ihm das Leben gerettet hat. Schuld an Boccards Tod ist er deshalb jedoch nicht. Gasparde hat
diese Pistole zu ihrem Schutz an sich genommen und sich damit auch wirklich schützen können. Dass sie sie im Moment der Flucht verliert,
erscheint ebenso unabwendbar wie der Umstand, dass die daraus abgefeuerte Kugel Boccard trifft. Für Schadau allerdings muss dies zu einem
starken Beweis dafür werden, dass ein ganz besonders unglücklich-glückliches Los über ihn verhängt ist.
~~~~~~~~~~~~
 "Ich rechne es mir zur Ehre, Euch einen Gegendienst zu leisten für die Gefälligkeit, mit der Ihr mir seinerzeit das schöne
württembergische Siegel gezeigt habt ..."
"Ich rechne es mir zur Ehre, Euch einen Gegendienst zu leisten für die Gefälligkeit, mit der Ihr mir seinerzeit das schöne
württembergische Siegel gezeigt habt ..."
Mit dem Gegendienst des Böhmen für die 'unwillkürliche' Geste Schadaus am Bieler See (siehe
2. KAPITEL) tritt eine weitere Ereignisverkettung ein. Dass
Schadau darin eine glückliche Fügung sieht, ist zu verstehen, was noch daraus folgt, scheint sich seinem Blick aber wohl zu entziehen.
~~~~~~~~~~~~
 "Seht, als ein vorsichtiger Mann ließ ich mir für alle Fälle von meinem gnädigen Herzog Heinrich für mich
und meine Leute, die wir gestern Nacht dem Admiral unsere Aufwartung machten", diese Worte begleitete er mit einer Mordgebärde,
vor der mir schauderte ...
"Seht, als ein vorsichtiger Mann ließ ich mir für alle Fälle von meinem gnädigen Herzog Heinrich für mich
und meine Leute, die wir gestern Nacht dem Admiral unsere Aufwartung machten", diese Worte begleitete er mit einer Mordgebärde,
vor der mir schauderte ...
Diese Andeutungen besagen nichts anderes, als dass der Böhme bei dem Mordkommando war, das Coligny in der Bartholomäusnacht
umgebracht hat. Das aber bedeutet auch: Wenn er damals entkommen ist, um Schadau jetzt retten zu können, so ist er
auch entkommen, um an dem Mord an Coligny beteiligt zu sein - eine angesichts der Bedeutung Colignys schreckliche Ausdehnung dieses
Schicksalsstranges. Ist es jedoch richtig zu folgern, dass "in der pharisäisch-egozentrischen Welt
Schadaus ... ein solcher göttlicher Ratschluß durchaus möglich" erscheint?

Mehr als einen 'Schauder' braucht Schadau hier doch nicht zu empfinden. Da der Böhme Coligny nicht allein überfallen hat, hing von seiner
Mitwirkung die Mordtat nicht ab. Man brauchte sich jedoch nur vorzustellen, er wäre ein Einzeltäter, um die ganze Tragweite des
Schadau'schen Prädestinations-Denkens zu ermessen: jede Tat, selbst die einfachste Hilfeleistung könnte bei einem solchen
Kausaldenken die Beteiligung an einem später ausgeführten Mord bedeuten. Vielleicht ist dies die 'herbe Konsequenz der
calvinistischen Lehre', an der Schadau in jungen Jahren seinen Geist übt.
Bewusst machen kann man sich an dieser Wendung der Geschichte aber jedenfalls, dass die in der jüngeren Fachliteratur breit
geführte Diskussion um Schadaus Toleranz oder Intoleranz in religiösen Fragen an dem gedanklichen Kern dieser Novelle
vorbeigeht. Ihr Thema ist nicht der Glaubensstreit, sondern die Frage, ob eine solche Verkettung von Ereignissen, wie sie hier vorliegt, für Zufall
gehalten werden kann oder ob sie nicht auf Bestimmung beruht. Für Schadau ist die Antwort klar, der Leser muss sich seine selbst geben.
Zehntes Kapitel
 Ich antwortete nicht, aber ... meine Gedanken verklagten und entschuldigten sich untereinander.
Ich antwortete nicht, aber ... meine Gedanken verklagten und entschuldigten sich untereinander.
Indem Schadau sich das Resultat seiner Reise nach Paris vor Augen hält - nur wenige Monate ist
der knapp 20-Jährige unterwegs -, wird ihm die ganze Widersprüchlichkeit der durchlebten Ereignisse klar. Er hat, wie er
es sich bestimmt wünschte, eine geliebte Frau unter Lebensgefahr mit in seine Heimat gebracht, aber er hat auch einen Freund
dafür sterben sehen. Für seine Glücksgefühle muss er sich des verlorenen Freundes wegen 'verklagen', darf
sich zugleich aber auch für sie 'entschuldigen', da er den Tod des Freundes nicht verursacht hat. Deutlich nimmt er aber
die Doppelnatur des über ihn Verhängten wahr.
Die von einem Teil der Fachliteratur ihm nachgesagte Borniertheit und Unbelehrtheit - von Meyer dem Leser angeblich
zwischen den Zeilen vorgeführt - stellt deshalb eine schwer zu begreifende Fehldeutung dar. Wenn Schadau zu Anfang noch in
einer Art naivem Gottvertrauen annimmt, dass es vom Schicksal Begünstigte und Benachteiligte gibt und er sicherlich wohl
zu den Begünstigten gehören wird, weiß er jetzt, dass jedes Glück seinen Preis hat oder haben kann und dass man
sich auf seine Bevorzugung durch Gott oder das Schicksal nichts einbilden darf. Mag er am Ende mit seinem Los auch zufrieden sein
- ein heiteres Lebensgefühl wie das Boccards ist das nicht.
~~~~~~~~~~~~
 In der Stille leg' ich ab / Pilgerschuh und Wanderstab.
In der Stille leg' ich ab / Pilgerschuh und Wanderstab.
Diese wie eine Gedichtzeile wirkende Formulierung lehnt sich an das Siegel des Oheims mit seiner Devise 'Pèlerin et Voyageur' an (siehe
8. KAPITEL). In dem Gedicht "Ein Pilgrim" hat Meyer eine Art Herkunftserklärung
für dieses Motto geliefert - dass er nämlich selbst einmal in Italien von einem Kind so benannt worden war. In der Fassung von 1891 lautet
das schon 1860 zu Teilen notierte Gedicht:
|
Ein Pilgrim
's ist im Sabinerland ein Kirchentor
- Mir war ein Reisejugendtag erfüllt -,
Ich saß auf einer Bank von Stein davor,
In einen langen Mantel eingehüllt,
Aus dem Gebirge blies ein harscher Wind -
Vorüber schritt ein Weib mit einem Kind,
Das, zu der Mutter flüsternd, scheu begann:
Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann!
Mir blieb das Wort des Kindes eingeprägt,
Und wo ich neues Land und Meer erschaut,
Den Wanderstecken neben mich gelegt,
Wo das Geheimnis einer Ferne blaut,
Ergriff mich unersättlich Lebenslust
Und füllte mir die Augen und die Brust,
Hell in die Lüfte jubelnd rief ich dann:
Ich bin ein Pilgerim und Wandersmann!
Es war am Comer- oder Langensee,
Auf lichter Tiefe trug das Boot mich hin
Entgegen meinem ewgen stillen Schnee
Mit einer andern lieben Pilgerin -
Rasch zog mir meine Schwester aus dem Haar,
Dem braungelockten, eins, das silbern war,
Und es betrachtend, seufzt ich leicht und sann:
Du bist ein Pilgerim und Wandersmann!
Mit Weib und Kind an meinem eignen Herd
In einer häuslich trauten Flamme Schein
Dünkt keine Ferne mir begehrenswert.
So ist es gut! So sollt es ewig sein ...
Jetzt fällt das Wort mir plötzlich in den Sinn
Der kleinen furchtsamen Sabinerin,
Das Wort, das nimmer ich vergessen kann:
Da sitzt ein Pilgerim und Wandersmann!
|