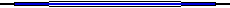[Fünfter Teil]
 Ein Kindelein so löbelich / Ist uns geboren heute ...
Ein Kindelein so löbelich / Ist uns geboren heute ...
Das Lied stammt aus der Zeit schon vor der Reformation und findet sich - mit kleinen Textabweichungen - in verschiedenen
Liederbüchern des 16. Jahrhunderts. Es wird oft auch mit der Strophe "Der Tag, der ist so freudenreich" eingeleitet
und dann unter diesem Titel geführt.
 Eine Aufnahme mit dem Knabenchor Hannover unter Heinz Hennig ('Vom Himmel hoch', Freiburger Musik Forum 1989)
Eine Aufnahme mit dem Knabenchor Hannover unter Heinz Hennig ('Vom Himmel hoch', Freiburger Musik Forum 1989)
Das heute viel bekanntere "Stille Nacht, heilige Nacht" gab es zur Zeit der Handlung der Novelle noch nicht, es wurde erst 1818 geschrieben.
~~~~~~~~~~~~
 "So liefen wir bis Heerse; da war es noch dunkel, und wir versteckten uns hinter das große Kreuz am Kirchhofe, bis es etwas heller
würde" ... Von da an hatten sie sich als wandernde Handwerksburschen durchgebettelt bis Freiburg im Breisgau.
"So liefen wir bis Heerse; da war es noch dunkel, und wir versteckten uns hinter das große Kreuz am Kirchhofe, bis es etwas heller
würde" ... Von da an hatten sie sich als wandernde Handwerksburschen durchgebettelt bis Freiburg im Breisgau.
In der Geschichte des 'Algierer-Sklaven' spielt sich die Flucht aus Bellersen völlig anders ab, ganz abgesehen davon, dass Winkelhannes
keinen Begleiter hatte. Er versteckte sich zunächst am Haus, lief dann seinem Gelübde entsprechend nach Werl und heuerte schließlich
in Holland auf einem Schiff an.
~~~~~~~~~~~~
 "Ja", sagte er dann, "es ging über Menschenkräfte und Menschengeduld; ich hielt es auch nicht aus. -
Von da kam ich auf ein holländisches Schiff." - "Wie kamst du denn dahin?", fragte der Gutsherr. - "Sie fischten mich auf, aus dem
Bosporus", versetzte Johannes.
"Ja", sagte er dann, "es ging über Menschenkräfte und Menschengeduld; ich hielt es auch nicht aus. -
Von da kam ich auf ein holländisches Schiff." - "Wie kamst du denn dahin?", fragte der Gutsherr. - "Sie fischten mich auf, aus dem
Bosporus", versetzte Johannes.
Auch die Zeit der Sklaverei - bei Haxthausen weit ausgeführt - wird von der Novelle anders wiedergegeben, weder die genannten
Stationen noch ihre Abfolge noch der Zeitumfang stimmen überein. Annette von Droste-Hülshoff wollte offenbar jede Ähnlichkeit
mit dem Sklaverei-Schicksal des Winkelhannes vermeiden.
~~~~~~~~~~~~
 Totenbleich kam er auf dem Schlosse an: in der Judenbuche hänge ein Mensch ... Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt.
Totenbleich kam er auf dem Schlosse an: in der Judenbuche hänge ein Mensch ... Die Leiche ward auf dem Schindanger verscharrt.
Hermann Winkelhannes hat sich nicht an dem Ort seiner Tat erhängt und schon gar nicht an dem Baum, der die Inschrift trug, sondern in einem
Waldstück etwa zehn Kilometer von dort entfernt. Und als Abweichung noch gravierender: er erhielt auf die Bitte des Gutsherren hin ein 'ehrliches
Begräbnis' auf dem Kirchhof von Bellersen.
Dass Friedrich Mergel dies verweigert wird, lässt sich zunächst mit seiner größeren Schuld erklären: Er gibt sich zum einen nicht zu
erkennen und verbirgt so weiterhin seine Tat, und er hat auch noch den mitgeschleppten Johannes auf dem Gewissen. Hinter dieser Konstellation steht
allerdings die Entscheidung der Autorin, die Umstände überhaupt so zuzuspitzen. Offensichtlich wollte sie einen noch dramatischeren (oder
romantischeren) Schluss in der Verbindung von Schuld und Sühne dadurch gewinnen, als die Geschichte des 'Algierer-Sklaven' ihn bietet.
Der Sühne-Gedanke findet sich dort allerdings auch schon:
So hat der Mensch 17 Jahre ungebeugt und ohne Verzweifelung die härteste Sklaverei des Leibes und Geistes ertragen, aber die Freiheit und
volle Straflosigkeit hat er nicht ertragen dürfen. Er mußte sein Schicksal erfüllen, und weil Blut für Blut, Leben für Leben
eingesetzt ist, ihn aber menschliches Gesetz nicht mehr erreichte, hat er, nachdem er lange Jahre fern umher geschweift, wieder durch des
Geschicks geheimnißvolle Gewalt zu dem Kreis, Ort und Boden des Verbrechens zurückgebannt, dort sich
selbst Gerechtigkeit geübt.